Für eine Teilhabe aller
Berlin 2023, Aufbau-Verlag
Der Titel des Buches des Historikers Oliver Zimmer und des Ökonomen Bruno S. Frey ist ein Zitat aus der Regierungserklärung des deutschen Kanzlers Willy Brand des Jahres 1969. „Brand argumentierte, dass die deutsche Demokratie nur durch erhöhte bürgerliche Partizipation zu sichern sei. […] Der Sozialdemokrat forderte eine deutsche Gesellschaft, die sich durch mehr ‚Mitbestimmung‘ und ‚Mitverantwortung‘ auszeichnen und dadurch ‚mehr Freiheit gewähren sollte.“ (10f) Angesichts dieser 55 Jahre alten Forderung kann man die Demokratien des Jahres 2024 (die österreichische genauso wie die deutsche, und umso mehr die europäische) nur als Rückschritt betrachten – als Rückschritt in das 19. Jahrhundert.
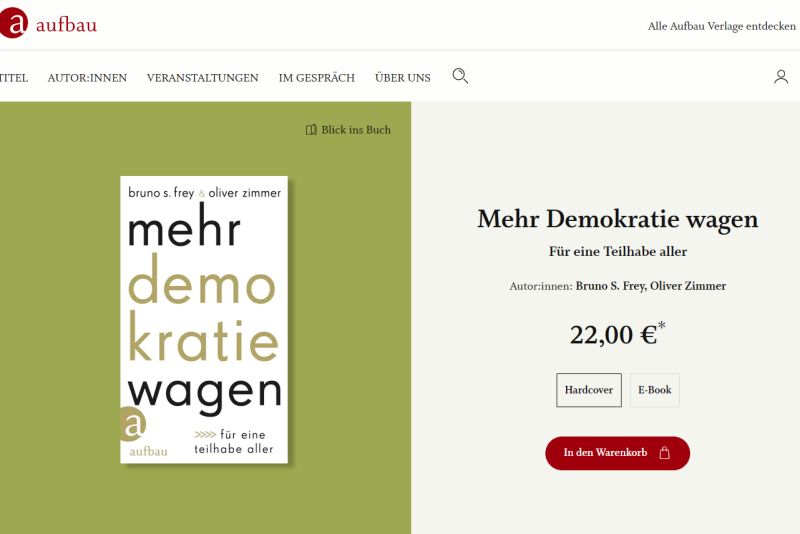
Die Anfänge der Demokratie und die im 18. und 19. Jahrhundert entwickelten Demokratie-Konzepte und -Theorien hat der Historiker Oliver Zimmer im vorliegenden Band auf 80 Seiten kompakt aufbereitet. Ein wichtiger Beitrag für das „Superwahljahr 2024“ (ORF.at 2.1.24). Schon einleitend nehmen die Autoren vorweg, dass „die herkömmliche Gleichsetzung von Repräsentation und Demokratie – konzeptuell wie historisch – unhaltbar ist.“ (12)
Zimmer sieht im Priester Emanuel Joseph Sieyès (1748-1836) den „Erfinder der modernen Repräsentativdemokratie“. 1789 wurde er „dank seinem eisernen Willen, seiner intellektuellen Brillanz und seinem Glauben an die eigene Mission innerhalb von Wochen zur welthistorischen Figur“ (27). Im Januar des Revolutionsjahres veröffentlichte er das Pamphlet Qu'est-ce que le Tiers-État? (Was ist der Dritte Stand?). Zimmer zitiert Sieyès: „Der Plan dieser Schrift ist ganz einfach: Wir haben uns drei Fragen vorzulegen. 1. Was ist der Dritte Stand? Alles. 2. Was ist er bis jetzt in der staatlichen Ordnung gewesen? Nichts. Was verlangt er? Etwas darin zu werden.“ (29)
Zimmer präzisiert: „Für Sieyès ist es nicht der König, der die Herrschaft im Staat ausüben soll, sondern die Nation in ihrer Gesamtheit. Diese definiert er als eine ‚Körperschaft von unter einem gemeinsamen Gesetz Assoziierten‘. Von seiner sozialen Substanz her entspricht die Nation nach Sieyès dem Dritten Stand der Bürger, der sich in vier wirtschaftlich produktive Klassen aufteilt: Bauern und Landarbeiter (Landwirtschaft); verschiedene Typen von Produzenten (Industrie); Ladenbesitzer und Händler (Handel); und schließlich die Vertreter der freien Berufe, inklusive Lehrer und Beamte. Diese letzte Gruppe, zu der Sieyès auch die Intellektuellen zählt, ist zuständig für das moralische Wohl des Staates“ (30). Der Dritte Stand verkörpert somit die französische Nation als Ganzes. So ist es konsequent, dass Sieyès Klerus und Adel auffordert, „dem Dritten Stand beizutreten und dadurch die ständische Ordnung ein für allemal zu begraben“ (31).
Der „Dritte Stand“ ist demnach keine „Klasse“ im marxistischen Sinne, aber auch keine Nation im nationalistischen Sinne – jedoch Grundlage für die Herausbildung beider Phänomene. So lehnten die Vertreter der Grande Nation selbstständige Provinzen als Provinzialismus und Partikularismus ab. Die daraus folgende Entwicklung des Nationalismus zum Zentralismus prägt Paris als Stadt mit 12,5 Millionen Einwohnern bis heute.
Die Verfechter von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit waren bekanntlich selbst weit von ihren Idealen entfernt. Das gilt auch für Sieyès, dem es vor allem darum ging, „den Herrschaftsbereich der Nation zugunsten einer Minderheit einzuschränken. Die Argumente, mit denen er diesen Schritt rechtfertigt, sind durch und durch epistokratisch: Konkret spricht er sich für die Herrschaft der Wissenden aus, die aufgrund ihrer angeblich überlegenen Einsichten den nationalen Willen repräsentieren sollen“ (39).
Der Historiker Zimmer spannt den Bogen von der Geschichte in die Gegenwart: „Der Grundgedanke des von Sieyès gegründeten Systems ist immer noch der gleiche. Danach sollen die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in ihrer überwiegenden Mehrheit keineswegs aktiv in Erscheinung treten; ihre Aufgabe besteht lediglich darin, dem repräsentativen System durch die Wahl von Volksvertretern ihre Reverenz zu erweisen“ (42).
Im zweiten Kapitel „Demokratie oder Epistokratie“ skizziert Oliver Zimmer die Demokratie-Modelle des 19. Jahrhunderts, in denen „die Macht einer gebildeten und wohlhabenden Minderheit vorbehalten blieb“ (43). Dieses Konzept verfestigte sich nach den Gewaltexzessen der Französischen Revolution um so mehr. Die meisten Vordenker waren zur Überzeugung gelangt, dass die Einführung der Demokratie einen langjährigen Entwicklungsprozess voraussetze, so auch der „herausragende Theoretiker dieser Weltanschauung, der französische Gelehrte und Politiker Franacois Guizot (1787-1874) … 1816 erschien sein erstes Werk zur repräsentativen Regierungsform in Frankreich. … 1830 stieg er zum wichtigsten Minister im Kabinett von König Louis Philippe I. auf“ (44f)
Originalzitat des Berufspolitikers aus dem Jahr 1821: „Was für das Kind und den Idioten gilt, trifft gleichermaßen auf die Menschheit zu: Das Recht zur Machtausübung entspringt stets der Vernunft, nie dem Willen. … Die Legitimation der Macht gründet allein im Einklang der Gesetze mit der ewigen Vernunft“ (45). Oliver Zimmer kommentiert: „Die konstitutionelle Monarchie, die nach der Revolution vom Sommer 1830 in Frankreich installiert wurde, kam der Verwirklichung dieser Doktrin sehr nahe. … Liberale wie Guizot sahen in der gleichzeitigen Befürwortung gleicher bürgerlicher und ungleicher politischer Rechte keinen Widerspruch. Denn genau genommen hielten sie das Wahlrecht nicht für ein Recht, sondern ein Privileg das man durch Vertrauen erst erwerben musste. … Demokratie ist hier nicht als demokratische Selbstbestimmung konzipiert, sondern als verfassungsstaatliches Regieren.“ (46f).
(Anmerkung HTH: Heute ersetzt die Expertokratie die Epistokratie, wobei die Experten selten die klügsten Köpfe, geschweige denn umfassend gebildete Menschen sind, sondern jene, die sich gefälligst dem Willen und den Interessen der Regierenden anpassen und unterordnen. Dieses Verhalten lernen „Experten“ heutzutage im Staatsdienst, somit auch an den staatlichen Universitäten. Die Herrschenden selbst sind alles andere als Epistokraten, sie sind bestenfalls Technokraten, also Spezialisten der Verwaltung, schlimmstenfalls und in der Regel jedoch Parteisoldaten, die Jahre oder Jahrzehnte als Befehlsempfänger Karriere machen, bevor sie selbst in Positionen kommen, wo Befehle erteilen müssen, womit die meisten überfordert sind.)
Im dritten Kapitel beantwortet Oliver Zimmer die Frage: „Wer gehört zum Demos – und wer bleibt außen vor?“ und beginnt mit der ernüchternden Erkenntnis: „Demokratien sind in der Praxis keineswegs unbegrenzt offen“ (59). In der Geschichte der Demokratien war der Ausschluss von Frauen das häufigste Manko, das zuerst in Neuseeland (1893) und zuletzt in demokratischen Musterland Schweiz (1971) aufgehoben wurde. In den Nationalstaaten, die sich im 18. Jahrhundert herausgebildet haben, herrschte das Patriarchat. Das hat sich auch im 20. Jahrhundert nicht prinzipiell geändert. Frauen bekamen zwar immer mehr Möglichkeiten, am öffentlichen Leben teilzunehmen, aber meist nur in untergeordneten Rollen.
Das Wahlrecht der Frauen steht heute außer Frage. Doch die Demokratien sind immer noch weit entfernt von offenen, partizipativen Strukturen. Besonders krass zeigt sich das bei der Europäischen Union, die sich „zumindest in ihrer gegenwärtigen Ausprägung, mit demokratischer Mitbestimmung schlecht verträgt. … Von Ralf Dahrendorf stammt die Bemerkung, dass, würde sich die EU heute um Aufnahme in die Europäische Union bewerben, ihr Gesuch an den demokratischen Auflagen scheitern müsste, die sie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs an Neumitglieder stellte. Scheitern müsste es nicht nur wegen der Impotenz des EU-Parlaments, sondern wegen der bereits angesprochenen mangelnden Gewaltenteilung. Ein supranationales Gebilde, dessen oberstes Gericht die Rechtssetzung demokratisch legitimierter Parlamente bei Bedarf außer Kraft setzen darf, liegt näher beim aufgeklärten Absolutismus als bei der modernen Demokratie“ (69)
Der Historiker Zimmer beleuchtet auch die Gegenwart: „Heute manifestiert sich die Rebellion gegen die Demokratie in Form einer mit dem Prädikat ‚liberale Demokratie‘ bezeichneten Formaldemokratie. [Das ist eine] Gesellschaft mit möglichst geringem politischem Einspracheraum. Die Gefriertrocknung der Politik nach 1945 ist die Antwort auf ihre Überhitzung durch die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts. Demokratie, besonders in einer Republik, ist jedoch auf ein kollektives Selbst angewiesen, das sich territorial und kulturell verorten lässt. In unserer gegenwärtigen Welt gibt es ein solches Selbst(-Bewusstsein) nachweislich im lokalen, im regionalen und im nationalen Bereich. Im europäischen und im Weltmaßstab ist etwas Vergleichbares dagegen noch nicht erkennbar“ (71)
Im Gegensatz zur historischen Klärung der Wurzeln und daraus resultierenden Schwächen der repräsentativen Demokratie, die genau genommen repräsentative Regierungsformen sind (formale, aber keine gelebten Demokratien) ist der zweite Teil über die „Demokratie der Zukunft“ von Bruno S. Frey etwas eindimensional geraten durch die Fokussierung auf das Föderalismus-Prinzip. Visionär ist allerdings, dass er damit die üblichen Landesgrenzen überschreiten will. Als Beispiel nennt der die Bodensee-Region, die ihre spezifischen Interessen länderübergreifend (Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein) autonom (sogar mit eigener Steuerhoheit) vertreten könnte. Darüber hinaus sollten aber neue föderale Einheiten (Functional Overlapping Competing Jurisdictions FOCJ) geschaffen werden. Das sollen „virtuelle Regierungen“ nach Art der NGOs oder zwischenstaatlicher, internationaler Organisationen sein.
Außerdem empfiehlt Frey neue demokratische Abstimmungssysteme bzw. die Flexible Entscheidungsregel (FER). Damit soll es möglich werden, auch die Minderheit bei Entscheidungen zu berücksichtigen. Die Beispiele, die Frey anführt sind allerdings nicht überzeugend. So könne statt dem Bau einer Brücke, die 100 Millionen kostet, falls dafür nur eine knappe Mehrheit von 50,1 Prozent stimmt, eine Brücke um 49,9 Millionen gebaut werden, um auch dem Willen der Minderheit zu folgen.
Nicht zuletzt möchte Frey aus der griechischen Antike das Zufallsprinzip, genauer gesagt den „qualifizierten Zufall“ als Entscheidungsverfahren wiederbeleben. Dies ist angesichts des katastrophalen demokratiepolitischen Zustandes, in dem sich insbesondere die EU befindet, natürlich Zukunftsmusik. Frey hat allerdings auf der Orgel einer künftigen Demokratie bei weitem nicht alle Register gezogen. Es gibt weiter führende Modelle der liquid democracy, der Bürgerparlamente, der Basisdemokratie, des Konsensierens, die man in einen offenen Diskurs einbeziehen muss.
ERGÄNZUNG 7. Juli 2024 - „Mit nur 34 Prozent der Stimmen – und 20 Prozent der Wahlberechtigten – erhielt die sozialdemokratische Labor-Party 63 Prozent der Sitze im britischen Unterhaus. Das Mehrheitswahlrecht macht es möglich. Noch nie war dieser Verstärkereffekt für die siegreiche Partei so groß wie bei diesen Wahlen“, verweist Report24.news auf das jeweilige Wahlrecht als grundlegendes Problem der Demokratien.
