Vorwort zur 33. - 47. Auflage (Neubearbeitung)
Alle Zitate aus Projekt Gutenberg + Seitenangaben folgen der Ausgabe des Anaconda Verlags, München 2021
Am Schlusse einer Arbeit, die vom ersten kurzen Entwurf bis zur endgültigen Fassung eines Gesamtwerks von ganz unvorhergesehenem Umfang zehn Lebensjahre umfaßt, ziemt sich wohl ein Rückblick auf das, was ich gewollt und erreicht, wie ich es aufgefunden habe und wie ich heute dazu stehe.
In der Einleitung zur Ausgabe von 1918 – einem Fragment nach außen und innen – hatte ich gesagt, daß hier nach meiner Überzeugung die unwiderlegliche Formulierung eines Gedankens vorliege, den man nicht mehr bestreiten werde, sobald er einmal ausgesprochen sei. Ich hätte sagen sollen: sobald er verstanden sei. Denn dazu bedarf es, wie ich mehr und mehr einsehe, nicht nur in diesem Falle, sondern in der Geschichte des Denkens überhaupt einer neuen Generation, die mit der Anlage dazu geboren ist.
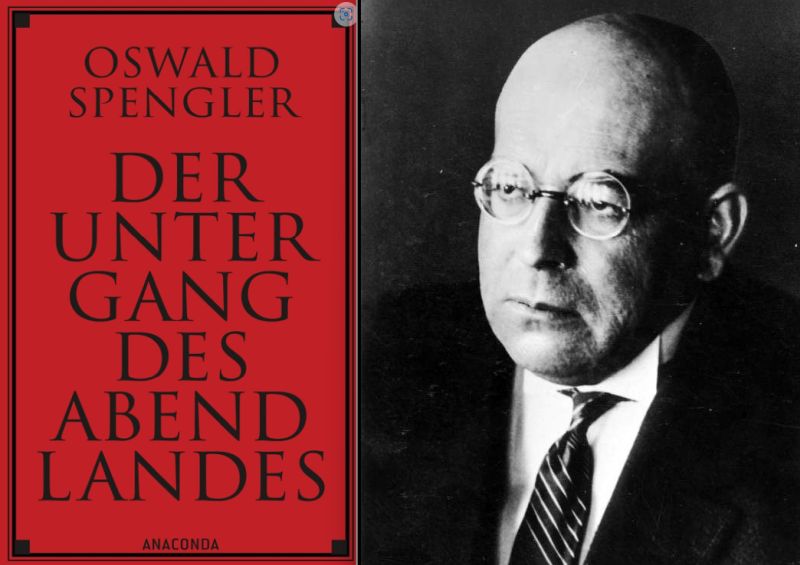
Ich hatte hinzugefügt, daß es sich um einen ersten Versuch handle, mit allen Fehlern eines solchen behaftet, unvollständig und sicherlich nicht ohne inneren Widerspruch. Diese Bemerkung ist bei weitem nicht so ernst genommen worden, wie sie gemeint war. Wer je einen tiefen Blick in die Voraussetzungen lebendigen Denkens getan hat, der wird wissen, daß eine widerspruchslose Einsicht in die letzten Gründe des Daseins uns nicht gegeben ist. Ein Denker ist ein Mensch, dem es bestimmt war, durch das eigene Schauen und Verstehen die Zeit symbolisch darzustellen. Er hat keine Wahl. Er denkt, wie er denken muß, und wahr ist zuletzt für ihn, was als Bild seiner Welt mit ihm geboren wurde. Es ist das, was er nicht erfindet, sondern in sich entdeckt. Es ist er selbst noch einmal, sein Wesen in Worte gefaßt, der Sinn seiner Persönlichkeit als Lehre geformt, unveränderlich für sein Leben, weil es mit seinem Leben identisch ist. Nur dieses Symbolische ist notwendig, Gefäß und Ausdruck menschlicher Geschichte. Was als philosophische Gelehrtenarbeit entsteht, ist überflüssig und vermehrt lediglich den Bestand einer Fachliteratur.
So vermag ich denn den Kern dessen, was ich gefunden habe, nur als »wahr« zu bezeichnen, wahr für mich, und, wie ich glaube, auch für die führenden Geister der kommenden Zeit, nicht wahr »an sich«, abgelöst nämlich von den Bedingungen von Blut und Geschichte, denn dergleichen gibt es nicht. Aber was ich im Sturm und Drang jener Jahre schrieb, war allerdings eine sehr unvollkommene Mitteilung dessen, was deutlich vor mir stand, und es blieb die Aufgabe der folgenden Jahre, durch die Anordnung von Tatsachen und den sprachlichen Ausdruck meinen Gedanken die mir erreichbare eindringliche Gestalt zu geben.
Vollenden läßt sie sich nie – das Leben selbst vollendet erst der Tod. Aber ich habe noch einmal versucht, auch die ältesten Teile auf die Höhe anschaulicher Darstellung zu heben, die mir heute zu Gebote steht, und damit nehme ich Abschied von dieser Arbeit mit ihren Hoffnungen und Enttäuschungen, ihren Vorzügen und Fehlern.
Das Ergebnis hat inzwischen seine Probe für mich bestanden, auch für andre, wenn ich nach der Wirkung urteilen darf, die es auf weite Wissensgebiete langsam auszuüben beginnt. Um so schärfer habe ich die Grenze zu betonen, die ich mir selbst in diesem Buch gesetzt habe. Man suche nicht alles darin. Es enthält nur eine Seite von dem, was ich vor mir sehe, einen neuen Blick allein auf die Geschichte, eine Philosophie des Schicksals, und zwar die erste ihrer Art. Es ist anschaulich durch und durch, geschrieben in einer Sprache, welche die Gegenstände und die Beziehungen sinnlich nachzubilden sucht, statt sie durch Begriffsreihen zu ersetzen, und es wendet sich allein an Leser, welche die Wortklänge und Bilder ebenso nachzuerleben verstehen. Dergleichen ist schwer, besonders wenn die Ehrfurcht vor dem Geheimnis – die Ehrfurcht Goethes – uns hindert, begriffliche Zergliederungen für Tiefblicke zu halten.
Da erhebt sich denn das Geschrei über Pessimismus, mit dem die Ewiggestrigen jeden Gedanken verfolgen, der nur für die Pfadfinder des Morgen bestimmt ist. Indessen habe ich nicht für solche geschrieben, welche das Grübeln über das Wesen der Tat für eine Tat halten. Wer definiert, der kennt das Schicksal nicht.
Die Welt verstehen nenne ich der Welt gewachsen sein. Die Härte des Lebens ist wesentlich, nicht der Begriff des Lebens, wie es die Vogel-Strauß-Philosophie des Idealismus lehrt. Wer sich nichts von Begriffen vormachen läßt, empfindet das nicht als Pessimismus, und auf die andern kommt es nicht an. Für ernste Leser, welche einen Blick auf das Leben suchen statt einer Definition, habe ich angesichts der allzu gedrängten Form des Textes in den Anmerkungen eine Anzahl von Werken genannt, die diesen Blick über fernliegende Gebiete unseres Wissens hinleiten können.
Zum Schlusse drängt es mich, noch einmal die Namen zu nennen, denen ich so gut wie alles verdanke: Goethe und Nietzsche. Von Goethe habe ich die Methode, von Nietzsche die Fragestellungen, und wenn ich mein Verhältnis zu diesem in eine Formel bringen soll, so darf ich sagen: ich habe aus seinem Ausblick einen Überblick gemacht. Goethe aber war in seiner gesamten Denkweise, ohne es zu wissen, ein Schüler von Leibniz gewesen. So empfinde ich das, was mir zu meiner eigenen Überraschung zuletzt unter den Händen entstanden ist, als etwas, das ich trotz des Elends und Ekels dieser Jahre mit Stolz nennen will: als eine deutsche Philosophie.
Blankenburg a. H., Dezember 1922
Oswald Spengler
SIEHE AUCH: Egon Friedell über Oswald Spenger
Nur wenige Jahre nach dem „Untergang des Abendlandes“ erschien 1927-31 die „Kulturgeschichte der Neuzeit“. Auch Friedell erörtert in einer umfangreichen Einleitung seine geschichtsphilosophische Grundsatz-Frage: „Was heißt und zu welchem Ende studiert man Kulturgeschichte?“ Dabei zählt er eine „Liste von Vorgängern“ auf, beginnen von Lessing und Herder, über Hegel u.a. bis: Oswald Spengler.
Einleitung
Die Arbeit an seinem 1470 Seiten umfassenden Monumentalwerk hat Oswald Spengler ein paar Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges begonnen. Es besteht aus zwei Bänden: Teil 1 (erschienen 1918 bei Braumüller, Wien) Gestalt und Wirklichkeit; Teil 2 (erschienen 1922 bei C.H. Beck, München) Welthistorische Perspektiven. Allein die Einleitung umfasst 80 Seiten. Hier stellt der Autor seine geschichtsphilosophische Konzeption vor, ausgehend von der Frage: „Gibt es eine Logik der Geschichte?“ (23)
Spengler erweitert und präzisiert die Fragestellung: „Gibt es jenseits von allem Zufälligen und Unberechenbaren der Einzelereignisse eine sozusagen metaphysische Struktur der historischen Menschheit, die von den weithin sichtbaren, populären, geistig-politischen Gebilden der Oberfläche wesentlich unabhängig ist? Die diese Wirklichkeit geringeren Ranges vielmehr erst hervorruft? Erscheinen die großen Züge der Weltgeschichte dem verstehenden Auge vielleicht immer wieder in einer Gestalt, die Schlüsse zuläßt? Und wenn – wo liegen die Grenzen derartiger Folgerungen? Ist es möglich, im Leben selbst – denn menschliche Geschichte ist der Inbegriff von ungeheuren Lebensläufen, als deren Ich und Person schon der Sprachgebrauch unwillkürlich Individuen höherer Ordnung wie »die Antike«, »die chinesische Kultur« oder »die moderne Zivilisation« denkend und handelnd einführt – die Stufen aufzufinden, die durchschritten werden müssen, und zwar in einer Ordnung, die keine Ausnahme zuläßt? Haben die für alles Organische grundlegenden Begriffe, Geburt, Tod, Jugend, Alter, Lebensdauer, in diesem Kreise vielleicht einen strengen Sinn, den noch niemand erschlossen hat? Liegen, kurz gesagt, allem Historischen allgemeine biographische Urformen zugrunde?“ (23 f) [Hervorhebungen ethos.at]
Die positiven Antworten sind in allen einzelnen Fragen bereits vorweggenommen, als Axiome seiner Philosophie. Nur eine Frage bleibt zunächst offen: „wo liegen die Grenzen derartiger Folgerungen?“ Doch er liefert auch dafür die Antwort: „die für alles Organische grundlegenden Begriffe, Geburt, Tod, Jugend, Alter, Lebensdauer“, also die Betrachtung der Geschichte als lebenden Organismus – das ist die Grenze des Chronos der Geschichtsschreibung, die sich damit vom Kosmos der Natur unterscheidet: „Das Mittel, tote Formen zu erkennen, ist das mathematische Gesetz. Das Mittel, lebendige Formen zu verstehen, ist die Analogie. Auf diese Weise unterscheiden sich Polarität und Periodizität der Welt.“ (24) Natur und Geschichte stehen nicht in Widerspruch; der Mensch ist Glied der Natur ebenso wie Glied der Geschichte.
Spengler sieht den häufigsten Fehler der Historiker darin, dass sie Ereignisse (Erscheinungen) nach dem (naturwissenschaftlichen) Kausalitätsprinzip darstellen; dies sei „nichts als ein Stück verkappter Naturwissenschaft“. (28) Auch jene Historiker, die einzelne Analogien unterschiedlicher Epochen auf gut Glück gefunden haben, bleiben auf halbem Weg stehen. In einer Fußnote merkt er an: „Neben dem Physiker und Mathematiker wirkt der Historiker nachlässig, sobald er von der Sammlung und Ordnung seines Materials zur Deutung übergeht.“ (30)
Zum Verständnis der Natur gebrauchen Wissenschafter die mathematische Zahl (zur Messung des Was und Wieviel), zum Verständnis der Geschichte brauchen Historiker die chronologische Zahl (zur Auskunft über das Wann). „Die Mathematik und das Kausalitätsprinzip führen zu einer naturhaften, die Chronologie und die Schicksalsidee zu einer historischen Ordnung der Erscheinung. Beide Ordnungen umfassen, jede für sich, die ganze Welt. Nur das Auge, in dem und durch das sich diese Welt verwirklicht, ist ein anderes.“ (31) Schicksal ist für Spengler kein Synonym für Zufall, ganz im Gegenteil: Unser Schicksal ist notwendig, so wie die natürliche Entwicklung eines Organismus, von der Geburt bis zum Tod. Das gilt für den Menschen ebenso wie für das „Menschentum“, insbesondere die „Geschichte des höheren Menschentums.“ (97)
Nochmals in anderen Worten: „Natur ist die Gestalt, unter welcher der Mensch hoher Kulturen den unmittelbaren Eindrücken seiner Sinne Einheit und Bedeutung gibt. Geschichte ist diejenige, aus welcher seine Einbildungskraft das lebendige Dasein der Welt in bezug auf das eigene Leben zu begreifen und diesem damit eine vertiefte Wirklichkeit zu verleihen sucht. Ob er dieser Gestaltungen fähig ist und welche von ihnen sein waches Bewußtsein beherrscht, das ist eine Urfrage aller menschlichen Existenz.“ (31) „Die Geschichte trägt das Merkmal des Einmalig-tatsächlichen, die Natur des Ständig-möglichen. (276)
Den Begriff „Weltgeschichte“ differenziert Spengler. Einerseits ist es die europäische Sicht auf die Welt seit Zeiten des Kolonialismus, oder auch das Bild anderer Kulturen auf ihre eigene Welt, anderseits ist es das „öde Bild“ einer linienförmigen Weltanschauung, der ein „zoologischer Begriff“ von „Menschheit“ zugrunde liegt. „Aber »die Menschheit« hat kein Ziel, keine Idee, keinen Plan, so wenig wie die Gattung der Schmetterlinge oder der Orchideen ein Ziel hat. »Die Menschheit« ist ein zoologischer Begriff oder ein leeres Wort.»Die Menschheit? Das ist ein Abstraktum. Es hat von jeher nur Menschen gegeben und wird nur Menschen geben« (Goethe zu Luden).“ (53)
Das „Menschentum“ dagegen ist ein lebendiger Organismus, und so wie jeder Organismus zeitlich und örtlich begrenzt. Fast romantisch schwärmerisch schreibt Spengler: „Ich sehe statt jenes öden Bildes einer linienförmigen Weltgeschichte, das man nur aufrecht erhält, wenn man vor der überwiegenden Menge der Tatsachen das Auge schließt, das Schauspiel einer Vielzahl mächtiger Kulturen, die mit urweltlicher Kraft aus dem Schoße einer mütterlichen Landschaft, an die jede von ihnen im ganzen Verlauf ihres Daseins streng gebunden ist, aufblühen, von denen jede ihrem Stoff, dem Menschentum, ihre eigne Form aufprägt, von denen jede ihre eigne Idee, ihre eignen Leidenschaften, ihr eignes Leben, Wollen, Fühlen, ihren eignen Tod hat. Hier gibt es Farben, Lichter, Bewegungen, die noch kein geistiges Auge entdeckt hat. Es gibt aufblühende und alternde Kulturen, Völker, Sprachen, Wahrheiten, Götter, Landschaften, wie es junge und alte Eichen und Pinien, Blüten, Zweige und Blätter gibt, aber es gibt keine alternde »Menschheit«. Jede Kultur hat ihre neuen Möglichkeiten des Ausdrucks, die erscheinen, reifen, verwelken und nie wiederkehren. Es gibt viele, im tiefsten Wesen völlig voneinander verschiedene Plastiken, Malereien, Mathematiken, Physiken, jede von begrenzter Lebensdauer, jede in sich selbst geschlossen, wie jede Pflanzenart ihre eigenen Blüten und Früchte, ihren eignen Typus von Wachstum und Niedergang hat. Diese Kulturen, Lebewesen höchsten Ranges, wachsen in einer erhabenen Zwecklosigkeit auf wie die Blumen auf dem Felde. Sie gehören, wie Pflanzen und Tiere, der lebendigen Natur Goethes, nicht der toten Natur Newtons an.“ (53 f)
Weiter unten ergänzt Spengler: „Ich erinnere an Goethe. Was er die lebendige Natur genannt hat, ist genau das, was hier Weltgeschichte im weitesten Umfange, die Welt als Geschichte genannt wird. Goethe, der als Künstler wieder und immer wieder das Leben, die Entwicklung seiner Gestalten, das Werden, nicht das Gewordene, herausbildete, wie es der »Wilhelm Meister« und »Wahrheit und Dichtung« zeigen, haßte die Mathematik. Hier stand die Welt als Mechanismus der Welt als Organismus, die tote der lebendigen Natur, das Gesetz der Gestalt gegenüber. Jede Zeile, die er als Naturforscher schrieb, sollte die Gestalt des Werdenden, »geprägte Form, die lebend sich entwickelt«, vor Augen stellen. Nachfühlen, Anschauen, Vergleichen, die unmittelbare innere Gewißheit, die exakte sinnliche Phantasie – das waren seine Mittel, dem Geheimnis der bewegten Erscheinung nahe zu kommen. Und das sind die Mittel der Geschichtsforschung überhaupt.“ (60)
In einer Fußnote verstärkt er diesen Gedanken emphatisch: „An folgendem Ausspruch möchte ich nicht ein Wort geändert wissen: »Die Gottheit ist wirksam im Lebendigen, aber nicht im Toten; sie ist im Werdenden und sich Verwandelnden, aber nicht im Gewordenen und Erstarrten. Deshalb hat auch die Vernunft in ihrer Tendenz zum Göttlichen es nur mit dem Werdenden, Lebendigen zu tun, der Verstand mit dem Gewordenen, Erstarrten, dass er es nutze« (zu Eckermann). Dieser Satz enthält meine ganze Philosophie.“ (100)
[...] man sah die Geschichte als Natur, im Objektsinne des Physikers, und behandelte sie danach. Von hierher schreibt sich der folgenschwere Mißgriff, die Prinzipien der Kausalität, des Gesetzes, des Systems, also die Struktur des starren Seins in den Aspekt des Geschehens zu legen. Man verhielt sich, als gebe es eine menschliche Kultur, etwa wie es Elektrizität oder Gravitation gibt, mit den im wesentlichen gleichen Möglichkeiten der Analyse; man hatte den Ehrgeiz, die Gewohnheiten des Naturforschers zu kopieren, so daß man wohl gelegentlich fragte, was denn die Gotik, der Islam, die antike Polis sei, nicht aber, warum diese Symbole eines Lebendigen gerade damals und dort auftauchen mußten, in dieser Form und für diese Dauer. Man begnügte sich, sobald eine der zahllosen Ähnlichkeiten räumlich und zeitlich weit getrennter Geschichtsphänomene zutage trat, sie einfach zu registrieren, mit einigen geistvollen Bemerkungen über das Wunderbare des Zusammentreffens, über Rhodos als das »Venedig des Altertums« oder Napoleon als den neuen Alexander, statt gerade hier, wo das Schicksalsproblem als das eigentliche Problem der Historie (das Problem der Zeit nämlich) hervortritt, den höchsten Ernst wissenschaftlich geregelter Physiognomik einzusetzen und die Antwort auf die Frage zu finden, welche ganz anders geartete Notwendigkeit, der kausalen ganz und gar fremd, hier am Werke ist. Daß jede Erscheinung auch dadurch ein metaphysisches Rätsel aufgibt, daß sie zu einer niemals gleichgültigen Zeit auftritt, daß man sich auch noch fragen muß, was für ein lebendiger Zusammenhang neben dem anorganisch-naturgesetzlichen im Weltbilde besteht – das ja die Ausstrahlung des ganzen Menschen und nicht, wie Kant meinte, nur die des erkennenden ist –, daß eine Erscheinung nicht nur Tatsache für den Verstand, sondern auch Ausdruck des Seelischen ist, nicht nur Objekt, sondern auch Symbol, und zwar von den höchsten religiösen und künstlerischen Schöpfungen an bis zu den Geringfügigkeiten des Alltagslebens, das war philosophisch etwas Neues. (100 f)
Kulturen als „Lebewesen höchsten Ranges“ sind von Zivilisationen zu unterscheiden. Beide Begriffe werden von vielen Historikern nicht scharf unterschieden, für Spengler aber ist klar: „Der Untergang des Abendlandes, so betrachtet, bedeutet nichts Geringeres als das Problem der Zivilisation. Eine der Grundfragen aller höheren Geschichte liegt hier vor. Was ist Zivilisation, als organisch-logische Folge, als Vollendung und Ausgang einer Kultur begriffen?
Denn jede Kultur hat ihre eigne Zivilisation. Zum ersten Male werden hier die beiden Worte, die bis jetzt einen unbestimmten Unterschied ethischer Art zu bezeichnen hatten, in periodischem Sinne, als Ausdrücke für ein strenges und notwendiges organisches Nacheinander gefaßt. Die Zivilisation ist das unausweichliche Schicksal einer Kultur. Hier ist der Gipfel erreicht, von dem aus die letzten und schwersten Fragen der historischen Morphologie lösbar werden. Zivilisationen sind die äußersten und künstlichsten Zustände, deren eine höhere Art von Menschen fähig ist. Sie sind ein Abschluß;“ (70)
„Der Untergang des Abendlandes, zunächst ein örtlich und zeitlich beschränktes Phänomen wie das ihm entsprechende des Untergangs der Antike, ist, wie man sieht, ein philosophisches Thema, das in seiner ganzen Schwere begriffen alle großen Fragen des Seins in sich schließt.“ (24) Am Ende der Einleitung präzisiert Spengler, was er mit allen „großen Fragen des Seins“ meint:
„Es bleibt noch das Verhältnis einer Morphologie der Weltgeschichte zur Philosophie festzustellen. Jede echte Geschichtsbetrachtung ist echte Philosophie – oder bloße Ameisenarbeit. Aber der systematische Philosoph bewegt sich, was die Dauer seiner Ergebnisse betrifft, in einem schweren Irrtum. Er übersieht die Tatsache, daß jeder Gedanke in einer geschichtlichen Welt lebt und damit das allgemeine Schicksal der Vergänglichkeit teilt. Er meint, daß das höhere Denken einen ewigen und unveränderlichen Gegenstand besitze, daß die großen Fragen zu allen Zeiten dieselben seien und daß sie endlich einmal beantwortet werden könnten.“ (86 f) Daraus folgt: „Jede Philosophie ist ein Ausdruck ihrer und nur ihrer Zeit.“ (87)
„Deshalb sehe ich den Prüfstein für den Wert eines Denkers in seinem Blick für die großen Tatsachen seiner Zeit. Erst hier entscheidet es sich, ob jemand nur ein geschickter Schmied von Systemen und Prinzipien ist, ob er sich nur mit Gewandtheit und Belesenheit in Definition und Analysen bewegt – oder ob es die Seele der Zeit selbst ist, die aus seinen Werken und Intuitionen redet. Ein Philosoph, der nicht auch die Wirklichkeit ergreift und beherrscht, wird niemals ersten Ranges sein.“ (88)
Zusammengefasst: Die Einleitung klärt die Schlüsselbegriffe, die für das Verständnis von Oswald Spengler von Bedeutung sind:
+ Geschichte im Unterschied zur Natur
+ der Mensch als Glied beider Betrachtungsweisen
+ die Logik der Geschichte folgt den für alles Organische grundlegenden Begriffen Geburt, Tod, Jugend, Alter, Lebensdauer.
+ mathematische (naturwissenschaftliche) versus chronologische (historische) Zahl
+ Weltgeschichte als Geschichte der Welt unterschiedlicher (zeitlich und räumlich beschränkter) Kulturen, nicht als lineare Aneinanderreihung historischer Ereignisse.
+ Zivilisation als Endstufe einer Kultur, die notwendig diese Entwicklungsstufe erreicht. Untergang bedeutet Vollendung, Vollendung bedeutet Ende.
+ Morphologie: Darstellung der Geschichte als organische Einheit von regelmäßiger Struktur. Auch: Physiognomik der Geschichte im Unterschied zur Systematik der Natur, Schicksalsidee versus Kausalitätsprinzip
+ echte Geschichtsbetrachtung ist echte Philosophie
Der letzte Satz ist mehr als ein Aphorismus. Diese Aussage ist gleichzeitig Grundlage und Inhalt von Spenglers Lebenswerk. Wer in dem Buch neue Deutungen von EREIGNISSEN oder TATSACHEN erwartet, die von Historikern schon tausendfach aufbereitet, mit neuen Erkenntnissen gewürzt und dann bewertet oder umgewertet wurden, wird enttäuscht. Das Buch ist vielmehr eine Deutung der ERSCHEINUNGEN und SCHICKSALE der uns bekannten Hochkulturen, der SEELEN dieser Kulturen, die alle so unterschiedlich sind, dass wir als Vertreter des Abendlandes beispielsweise die Seele des Altertums nicht wirklich nachvollziehen und (nach)empfinden können. Gemeinsam aber ist allen Hochkulturen die Morphologie (= Physiognomie) der WELTSEELE, nämlich die Genealogie von Geburt, Kindheit, Jugend, Reife, Alter und Tod.
Die Weltgeist manifestiert sich bei Hegel in den Heroen der Weltgeschichte (er folgt damit den Spuren der Geschichtsschreibung der Sieger). Die Weltseele zeigt sich in der ewigen Wiederkehr des gleichen Schicksals der Hochkulturen. Und das Schicksal einer Hochkultur manifestiert sich laut Spengler im Stil. Nicht nur im Stil der Architektur, sondern auch im Lebensstil, Wirtschaftsstil usw. Sein Buch kann man als „Stilgeschichte“ (347) lesen, nicht aber als Stilkunde – diese setzt Spengler voraus! Spengler: "Stile folgen nicht aufeinander wie Wellen und Pulsschläge. Mit der Persönlichkeit einzelner Künstler, ihrem Willen und Bewußtsein haben sie nichts zu schaffen." (345)
Zum besseren Verständnis hier Auszüge aus dem ersten Band, drittes Kapitel:
MAKROKOSMOS
I. Die Symbolik des Weltbildes und das Raumproblem
II. Apollinische, faustische, magische Seele
[Anm. HTH: Die Chronologie der folgenden Artikel und Auszüge folgt nicht der Chronologie des Buches, sondern der Chronologie meiner Lektüre des "Untergangs"]
Zweiter Band: WELTHISTORISCHE PERSPEKTIVE
Fünftes Kapitel: Die Formenwelt des Wirtschaftslebens
I. Das Geld
[...] Gerade darin aber offenbart sich der geheime Gang einer hohen Kultur. Am Anfang erscheinen die Urstände Adel und Priestertum mit ihrer Symbolik von Zeit und Raum. Damit haben, in einer wohlgeordneten Gesellschaft, Vgl. Bd. II, S. 966f. das politische Leben wie das religiöse Erleben ihren festen Platz, ihre berufenen Träger und ihre für Tatsachen wie für Wahrheiten schlechthin gegebenen Ziele, und in der Tiefe bewegt sich das Wirtschaftsleben in einer unbewußten sicheren Bahn. Der Strom des Daseins verfängt sich im steinernen Gehäuse der Stadt und von hier aus übernehmen Geld und Geist die geschichtliche Führung. Das Heldenhafte und Heilige mit der sinnbildlichen Wucht ihrer frühen Erscheinung werden selten und ziehen sich in enge Kreise zurück. Eine kühle bürgerliche Klarheit tritt an ihre Stelle. Im Grunde erfordern ein Systemabschluß und ein Geschäftsabschluß ein und dieselbe Art von fachmännischer Intelligenz. Durch den symbolischen Rang kaum noch getrennt, dringen politisches und wirtschaftliches Leben, religiöse und wissenschaftliche Erkenntnis aufeinander ein, berühren und mischen sich. Der Strom des Daseins verliert die strenge und reiche Form im Treiben der großen Städte. Elementare Wirtschaftszüge treten an die Oberfläche und treiben mit den Resten formvoller Politik ihr Spiel, wie gleichzeitig die souveräne Wissenschaft die Religion unter ihre Objekte aufnimmt. Über ein Leben von wirtschaftspolitischem Selbstgenügen breitet sich eine kritisch-erbauliche Weltstimmung. Aber aus ihm treten endlich an Stelle der zerfallenen Stände einzelne Lebensläufe von echt politischer und religiöser Gewalt hervor, die für das Ganze zum Schicksal werden.
Daraus ergibt sich die Morphologie der Wirtschaftsgeschichte. Es gibt eine Urwirtschaft »des« Menschen, die ebenso wie die der Pflanze und des Tiers ihre Form in biologischen Zeiträumen Vgl. Bd. II, S. 591. verändert. Sie beherrscht das primitive Zeitalter vollkommen und bewegt sich zwischen und in den hohen Kulturen ohne erkennbare Regel unendlich langsam und verworren fort. Tiere und Pflanzen werden herangezogen und durch Zähmung, Züchtung, Veredlung, Aussaat umgeschaffen, das Feuer und die Metalle ausgenützt, die Eigenschaften der unlebendigen Natur durch technische Verfahren in den Dienst der Lebenshaltung gestellt. Alles das ist durchdrungen von politisch-religiöser Sitte und Bedeutung, ohne daß totem und tabu, Hunger, Seelenangst, Geschlechtsliebe, Kunst, Krieg, Opferbrauch, Glaube und Erfahrung deutlich zu trennen wären.
Etwas ganz anderes nach Begriff und Entwicklung ist die strenggeformte und in Tempo und Dauer scharf begrenzte Wirtschaftsgeschichte der hohen Kulturen, von denen jede einzelne einen eignen Wirtschaftsstil besitzt. Zum Lehnswesen gehört die Wirtschaft des stadtlosen Landes. Mit dem von Städten aus regierten Staat erscheint die Stadtwirtschaft des Geldes, die sich mit dem Anbruch jeder Zivilisation zur Diktatur des Geldes erhebt, gleichzeitig mit dem Sieg der weltstädtischen Demokratie. Jede Kultur besitzt ihre selbständig entwickelte Formenwelt. Das körperhafte Geld apollinischen Stils – die geprägte Münze – steht dem faustisch-dynamischen Beziehungsgelde – der Buchung von Krediteinheiten – ebenso fern wie die Polis dem Staate Karls V. Aber das wirtschaftliche Leben bildet sich ganz wie das gesellschaftliche zu einer Pyramide aus.Vgl. Bd. II, S. 902.
Im dörflichen Untergrunde hält sich eine völlig primitive, kaum von der Kultur berührte Lage. Die späte Stadtwirtschaft, bereits das Tun einer entschiedenen Minderheit, sieht beständig auf eine frühzeitliche Landwirtschaft herab, die rings umher ihr Wesen weiter treibt und voll Argwohn und Haß auf den durchgeistigten Stil innerhalb der Mauern blickt. Zuletzt führt die Weltstadt eine – zivilisierte – Weltwirtschaft herauf, die von ganz engen Kreisen weniger Mittelpunkte ausstrahlt und den Rest als Provinzwirtschaft sich unterwirft, während in entlegenen Landschaften oft noch durchaus die primitive – »patriarchalische« – Sitte herrscht.
Mit dem Wachstum der Städte wird die Lebenshaltung immer künstlicher, feiner, verwickelter. Der Großstadtarbeiter im cäsarischen Rom, im Bagdad Harun al Raschids und im heutigen Berlin empfindet vieles als selbstverständlich, was dem reichen Bauern fern im Lande als wahnwitziger Luxus erscheint, aber dieses Selbstverständliche ist schwer zu erreichen und schwer zu behaupten; das Arbeitsquantum aller Kulturen wächst in ungeheurem Maße, und so entwickelt sich am Anfang jeder Zivilisation eine Intensität des Wirtschaftslebens, die in ihrer Spannung übertrieben und stets gefährdet ist und nirgends lange aufrecht erhalten werden kann. Zuletzt bildet sich ein starrer und dauerhafter Zustand heraus mit einem seltsamen Gemisch raffiniert durchgeistigter und ganz primitiver Züge, wie ihn die Griechen in Ägypten und wir im heutigen Indien und China kennen lernen, wenn er nicht vor dem unterirdischen Nachdrängen einer jungen Kultur dahinschwindet wie der antike zur Zeit Diokletians.
Dieser Wirtschaftsbewegung gegenüber sind die Menschen als Wirtschafts klasse in Form, wie sie es der Weltgeschichte gegenüber als politischer Stand sind. Jeder einzelne hat eine wirtschaftliche Stellung innerhalb der ökonomischen Gliederung so, wie er irgend einen Rang innerhalb der Gesellschaft einnimmt. Beide Arten von Zugehörigkeit nehmen gleichzeitig sein Fühlen, Denken und Sichverhalten in Anspruch. Ein Leben will da sein und darüber hinaus noch etwas bedeuten; und die Verwirrung unserer Begriffe ist endlich noch dadurch gesteigert worden, daß politische Parteien, heute wie in hellenistischer Zeit, gewisse wirtschaftliche Gruppen, deren Lebenshaltung sie glücklicher gestalten wollten, durch Erhebung in einen politischen Stand gewissermaßen adelten, wie es Marx mit der Klasse der Fabrikarbeiter getan hat.
Denn der erste und echte Stand ist der Adel. Von ihm leitet sich der Offizier und Richter ab und alles, was zu den hohen Regierungs- und Verwaltungsämtern gehört. Es sind standesartige Gebilde, die etwas bedeuten. Ebenso gehört zum Priestertum die GelehrtenschaftEinschließlich der Ärzte, die in Urzeiten von Priestern und Zauberern nicht zu trennen sind. mit einer sehr ausgeprägten Art von ständischer Abgeschlossenheit. Aber mit Burg und Dom ist die große Symbolik zu Ende. Der tiers ist bereits der Nichtstand, der Rest, eine bunte und vielfältige Sammlung, die als solche wenig bedeutet außer in Augenblicken des politischen Protestes, und die sich deshalb Bedeutung gibt, indem sie Partei ergreift. Man fühlt sich, nicht als Bürger, sondern weil man »liberal« ist, und also eine große Sache zwar nicht durch seine Person repräsentiert, aber ihr durch seine Überzeugung angehört. Infolge der Schwäche dieses gesellschaftlichen Geformtseins tritt das wirtschaftliche in »bürgerlichen« Berufen, Gilden und Verbänden um so sichtbarer hervor. In den Städten wenigstens ist ein Mensch zuerst durch das bezeichnet, wovon er lebt.
Wirtschaftlich ist das erste und ursprünglich fast das einzige das Bauerntum,Hirten, Fischer und Jäger gehören dazu. Außerdem besteht eine seltsame und sehr tiefe Beziehung zum Bergbau, wie die Verwandtschaft der alten Sagen und Bräuche lehrt. Die Metalle werden dem Schacht nicht anders abgelockt wie das Korn der Erde und das Wild dem Forst. Aber für den Bergmann sind die Metalle auch etwas, das lebt und wächst. die schlechthin erzeugende Art von Leben, die jede andre erst möglich macht. Auch die Urstände gründen ihre Lebenshaltung in früher Zeit durchaus auf Jagd, Viehhaltung und Ackerbesitz, und noch für Adel und Geistlichkeit der Spätzeiten ist es die einzig vornehme Möglichkeit, »begütert« zu sein. Ihr steht die vermittelnde, erbeutende Lebensart des HandelsVon der urzeitlichen Seefahrt bis zum weltstädtischen Börsengeschäft. Aller Verkehr auf Flüssen, Straßen, Bahnen gehört dazu.gegenüber, im Verhältnis zur kleinen Zahl von gewaltiger Macht und schon ganz früh unentbehrlich, ein feiner Parasitismus, vollkommen unproduktiv und deshalb landfremd und schweifend, »frei«, auch seelisch unbeschwert von Sitten und Bräuchen der Erde, ein Leben, das von anderem Leben sich nährt. Dazwischen wächst nun eine dritte Art von Wirtschaft heran, die verarbeitende der Technik in zahllosen Handwerken, Gewerben und Berufen, welche ein Nachdenken über die Natur zur schöpferischen Anwendung bringen und deren Ehre und Gewissen an der Leistung haftet.Vgl. Bd. II, S. 989. Auch die Maschinenindustrie gehört hierher mit dem rein abendländischen Typus des Erfinders und Ingenieurs, und praktisch ein großer Teil der modernen Landwirtschaft, z. B. in Amerika. Ihre älteste, bis in die Urzeit zurückreichende Zunft und zugleich ihr Urbild mit einer Fülle dunkler Sagen, Bräuche und Anschauungen sind die Schmiede, die infolge ihrer stolzen Absonderung vom Bauerntum und der um sie verbreiteten Scheu, die zwischen Achtung und Ächtung wechselt, oft zu wirklichen Volksstämmen eigner Rasse geworden sind wie die Falascha in Abessinien.Auch heute noch wird die Hütten- und Metallindustrie als irgendwie vornehmer empfunden wie etwa die chemische und elektrische. Sie hat den ältesten Adel der Technik, und ein Rest von kultischem Geheimnis liegt über ihr.
Im erzeugenden, verarbeitenden und vermittelnden Wirtschaftswesen gibt es wie in allem, was zur Politik und überhaupt zum Leben gehört, Subjekte und Objekte der Leitung und also ganze Gruppen, die anordnen, entscheiden, organisieren, erfinden, und andere, denen lediglich die Ausführung zusteht. Der Rangunterschied kann schroff oder kaum fühlbar,Bis zur Hörigkeit und Sklaverei, obwohl gerade die Sklaverei sehr oft, z. B. im heutigen Orient und in Rom bei den vernae, wirtschaftlich nichts als eine Form des aufgezwungenen Arbeitsvertrages ist und abgesehen davon kaum fühlbar wird. Der freie Angestellte lebt oft in viel härterer Abhängigkeit und geringerer Achtung, und das formelle Kündigungsrecht ist in vielen Fällen praktisch ganz bedeutungslos der Aufstieg unmöglich oder selbstverständlich, die Würde der Tätigkeit fast dieselbe mit langsamen Übergängen oder ganz verschieden sein. Tradition und Gesetz, Begabung und Besitz, Volkszahl, Kulturstufe und Wirtschaftslage beherrschen den Gegensatz, aber er ist da und zwar mit dem Leben selbst gegeben und unabänderlich. Trotzdem gibt es wirtschaftlich keine »Arbeiterklasse«; das ist eine Erfindung von Theoretikern, welche die Lage der Fabrikarbeiter in England, einem fast bauernlosen Industrielande, gerade in einer Übergangszeit vor Augen hatten und das Schema auf alle Kulturen zu allen Zeiten ausdehnten, bis es von Politikern zum Mittel von Parteigründungen erhoben wurde. In Wirklichkeit gibt es eine unabsehbare Zahl von Tätigkeiten rein dienender Art in Werkstatt und Kontor, Schreibstube und Schiffsraum, auf Landstraßen, in Schächten und in Wiese und Feld. Diesem Rechnen, Tragen, Laufen, Hämmern, Nähen, Aufpassen fehlt oft genug, was dem Leben über seine bloße Erhaltung hinaus Würde und Reiz gibt, wie es mit den standesgemäßen Aufgaben des Offiziers und Gelehrten oder den persönlichen Erfolgen des Ingenieurs, Verwalters und Kaufmanns der Fall ist, aber unter sich ist das alles ganz und gar nicht vergleichbar. Geist und Schwere der Arbeit, ihr Ort in Dorf oder Großstadt, Umfang und Gespanntheit des Betriebes lassen den Bauernknecht, Bankbeamten, Heizer und Schneidergesellen in ganz verschiedenen Welten der Wirtschaft leben und erst, ich wiederhole es, die Parteipolitik sehr später Zustände hat sie durch Schlagworte in eine Verbindung des Protestes gesetzt, um sich ihrer Masse zu bedienen. Dagegen ist der antike Sklave ein staatsrechtlicher Begriff, nämlich für den politischen Körper der antiken Polis nicht vorhanden,Vgl. Bd. II, S. 625. während er wirtschaftlich Bauer, Handwerker, selbst Direktor und Großkaufmann mit gewaltigem Vermögen ( peculium), mit Palästen und Villen und einer Schar von Untergebenen, auch auch »freien«, sein kann. Was er abgesehen davon in spätrömischer Zeit noch ist, wird sich weiter unten zeigen.
3
Mit dem Anbruch jeder Frühzeit beginnt ein Wirtschaftsleben in fester Form.Wir kennen es aus den ägyptischen und gotischen Anfängen genau, in China und der Antike in großen Zügen; und was die wirtschaftliche Pseudomorphose der arabischen Kultur betrifft (S. 784ff., 991), so erfolgt seit Hadrian ein innerer Abbau der hochzivilisierten antiken Geldwirtschaft bis zu einem frühzeitlichen Güterumlauf, der unter Diokletian erreicht ist, worauf im Osten der eigentlich magische Anstieg sichtbar wird. Die Bevölkerung lebt durchaus bäuerlich im freien Lande. Das Erlebnis der Stadt ist für sie nicht vorhanden. Was sich vom Dorfe, von Burg, Pfalz, Kloster, Tempelbezirk abhebt, ist nicht eine Stadt, sondern ein Markt, ein bloßer Treffpunkt bäuerlicher Interessen, der gleichzeitig und selbstverständlich eine gewisse religiöse und politische Bedeutung besitzt, ohne daß von einem Sonderleben die Rede sein kann. Die Einwohner, auch wenn sie Handwerker oder Kaufleute sind, empfinden doch als Bauern und werden irgendwie auch als solche tätig sein.
Was sich von einem Leben absondert, in dem jeder erzeugt und verbraucht, sind Güter, und Güterumlauf ist das Wort für jeden frühzeitlichen Verkehr, mag das Einzelne aus weiter Ferne herankommen oder nur innerhalb des Dorfes oder selbst des Hofes wandern. Ein Gut ist, was mit leisen Fäden seines Wesens, seiner Seele an dem Leben haftet, das es hervorgebracht hat oder braucht. Ein Bauer treibt »seine« Kuh zu Markte, eine Frau bewahrt »ihren« Schmuck in der Truhe. Man ist »begütert«, und das Wort Be-sitz führt bis in den pflanzenhaften Ursprung des Eigentums zurück, mit dem gerade dieses eine und kein anderes Dasein wurzelhaft verwachsen ist.Weder die Kupferstücke der italischen Villanovagräber aus frühhomerischer Zeit (Willers, Gesch. der römischen Kupferprägung, S. 18) noch die frühchinesischen Bronzemünzen in Gestalt von Frauengewändern (pu), Beilen, Ringen und Messern ( tsien, Conrady, China, S. 504) sind Geld, sondern deutlich genug als Symbole von Gütern bezeichnet; und auch die Münzen, welche die Regierungen der frühgotischen Zeit in Nachahmung der Antike als Hoheitszeichen schlagen ließen, treten in das Wirtschaftsleben nur als Güter ein: ein Stück Gold ist soviel wert wie eine Kuh, nicht umgekehrt. Tausch ist in dieser Zeit ein Vorgang, durch den Güter aus einem Lebenskreise in einen andern übergehen. Sie werden vom Leben gewertet, nach einem gleitenden, gefühlten Maße des Augenblicks. Es gibt weder einen Wertbegriff noch ein allgemein messendes Gut. Auch Gold und Münzen sind nichts als Güter, deren seltene und unzerstörbare Art sie wertvoll macht.
In den Takt und Gang dieses Güterumlaufs greift der Händler nur als Mittler ein.Deshalb geht er so oft nicht aus dem fest in sich geschlossenen Landleben hervor, sondern erscheint in ihm als Fremder, gleichgültig und voraussetzungslos. Das ist die Rolle der Phöniker in der frühesten Antike, der Römer im Osten zur Zeit des Mithridates, der Juden und daneben der Byzantiner, Perser, Armenier im gotischen Abendland, der Araber im Sudan, der Inder in Ostafrika, der Westeuropäer im heutigen Rußland. Auf dem Markt stoßen die erobernde und die erzeugende Wirtschaft zusammen, aber selbst dort, wo Flotten landen und Karawanen eintreffen, entwickelt sich der Handel nur als Organ des ländlichen Verkehrs.Und deshalb in sehr geringem Umfange. Weil der Fremdhandel damals abenteuerlich ist und die Phantasie beschäftigt, pflegt man ihn maßlos zu überschätzen. Die »großen« Kaufherren Venedigs und der Hanse waren um 1300 den angeseheneren Handwerksmeistern kaum ebenbürtig. Die Umsätze selbst der Medici und Fugger entsprachen um 1400 etwa denen eines Ladengeschäfts in einer heutigen Kleinstadt. Die größten Handelsschiffe, an denen in der Regel eine Gruppe von Kaufleuten beteiligt war, standen hinter den Flußkähnen der Gegenwart weit zurück und machten jährlich vielleicht eine größere Fahrt. Die berühmte englische Wollausfuhr, ein Hauptgegenstand des hansischen Handels, umfaßte um 1270 jährlich kaum die Ladung von zwei heutigen Güterzügen (Sombart, Der moderne Kapitalismus I, S. 280 ff.). Es ist die »ewige« Form der Wirtschaft, die sich heute noch mit der ganz urzeitlichen Figur des Hausierers in stadtarmen Landschaften hält, selbst in abgelegenen Vorstadtgassen, wo sich kleine Umlaufkreise bilden, und im Privathaushalt von Gelehrten, Beamten und überhaupt von Menschen, die dem großstädtischen Wirtschaftsleben nicht tätig eingegliedert sind.
Eine ganz andere Art von Leben erwacht mit der Seele der Stadt. Vgl.S. 661 f. Sobald der Markt zur Stadt geworden ist, gibt es nicht mehr bloße Schwerpunkte des Güterstroms, der durch eine rein bäuerliche Landschaft geht, sondern eine zweite Welt innerhalb der Mauern, für die das schlechthin erzeugende Leben »da draußen« nichts ist als Mittel und Objekt, und aus der heraus ein anderer Strom zu kreisen beginnt. Das ist das Entscheidende: der echte Städter ist nicht erzeugend im ursprünglich erdhaften Sinne. Ihm fehlt die innere Verbundenheit mit dem Boden wie mit dem Gut, das durch seine Hände geht. Er lebt nicht mit ihm, sondern er betrachtet es von außen und nur in bezug auf seinen Lebensunterhalt.
Damit wird das Gut zur Ware, der Tausch zum Umsatz, und an Stelle des Denkens in Gütern tritt das Denken in Geld.
Damit wird ein rein ausgedehntes Etwas, eine Form der Grenzsetzung, von den sichtbaren Wirtschaftsdingen abgezogen, ganz wie das mathematische Denken von der mechanisch aufgefaßten Umwelt etwas abzieht, und das Abstraktum Geld entspricht durchaus dem Abstraktum Zahl. Zum folgenden vgl. Bd. II, Kap. I Beides ist vollkommen anorganisch. Das Wirtschaftsbild wird ausschließlich auf Quantitäten zurückgeführt, unter Absehen von der Qualität, die gerade das wesentliche Merkmal des Gutes bildet. Für den frühzeitlichen Bauern ist »seine« Kuh zuerst gerade dieses eine Wesen und dann erst Tauschgut; für den Wirtschaftsblick eines echten Städters gibt es nur einen abstrakten Geldwert in der zufälligen Gestalt einer Kuh, der jederzeit in die Gestalt etwa einer Banknote umgesetzt werden kann. Ebenso erblickt der echte Techniker in einem berühmten Wasserfall nicht ein einzigartiges Naturschauspiel, sondern ein reines Quantum unverwerteter Energie.
Es ist ein Fehler aller modernen Geldtheorien, daß sie von den Wertzeichen oder sogar vom Stoff der Zahlungsmittel statt von der Form des wirtschaftlichen Denkens ausgehen. Mark und Dollar sind so wenig »Geld« wie Meter und Gramm Kräfte sind. Geld stücke sind Sachwerte. Nur weil wir die antike Physik nicht kannten, haben wir Gravitation und Gewichtsstück nicht verwechselt, wie wir es auf Grund der antiken Mathematik mit Zahl und Größe und infolge der Nachahmung antiker Münzen mit Geld und Geldstück getan haben und noch tun. Aber Geld ist wie Zahl und Recht eine Kategorie des Denkens. Es gibt ein Gelddenken so wie es ein juristisches, mathematisches, technisches Denken der Umwelt gibt. Von dem Sinnenerlebnis eines Hauses wird ganz Verschiedenes abgezogen, je nachdem man es als Händler, Richter oder Ingenieur im Geiste prüft und in bezug auf eine Bilanz, einen Rechtsstreit oder eine Einsturzgefahr hin wertet. Am nächsten aber steht dem Denken in Geld die Mathematik. Geschäftlich denken heißt rechnen. Der Geldwert ist ein Zahlenwert, der an einer Rechnungseinheit gemessen wird. Deshalb könnte man umgekehrt das metrische (cm-g) System eine Währung nennen, und in der Tat gehen sämtliche Geldmaße von physikalischen Gewichtssätzen aus. Diesen exakten »Wert an sich« hat, wie die Zahl an sich, erst das Denken des Städters, des wurzellosen Menschen hervorgebracht. Für den Bauern gibt es nur flüchtige, gefühlte Worte in bezug auf ihn, die er im Tausch von Fall zu Fall geltend macht. Was er nicht braucht oder besitzen will, hat für ihn »keinen Wert«. Erst im Wirtschaftsbilde des echten Städters gibt es objektive Werte und Wertarten, die als Elemente des Denkens unabhängig von seinem privaten Bedarf bestehen und der Idee nach allgemeingültig sind, obwohl in Wirklichkeit jeder einzelne sein eignes Wertsystem und seine eigne Fülle der verschiedensten Wertarten besitzt und von ihnen aus die geltenden Wertansätze (Preise) des Marktes als teuer oder billig empfindet.Ebenso sind alle Werttheorien, obwohl sie objektiv sein sollen, aus einem subjektiven Prinzip entwickelt, und es kann auch gar nicht anders sein. Die von Marx z. B. definiert »den« Wert so, wie es das Interesse des Handarbeiters fordert, so daß die Leistung des Erfinders und Organisators als wertlos erscheint. Aber es wäre verfehlt, sie als falsch zu bezeichnen. All diese Lehren sind richtig für ihre Anhänger und falsch für ihre Gegner, und ob man Anhänger oder Gegner wird, entscheiden nicht die Gründe, sondern das Leben.
Während der frühe Mensch Güter vergleicht und nicht nur mit dem Verstande, berechnet der späte den Wert der Ware, und zwar nach einem starren qualitätslosen Maß. Jetzt wird nicht mehr das Geld an der Kuh, sondern die Kuh am Gelde gemessen und das Ergebnis durch eine abstrakte Zahl, den Preis, ausgedrückt. Ob und in welcher Weise dieses Wertmaß in einem Wertzeichen sinnbildlichen Ausdruck findet – so wie das geschriebene, gesprochene, vorgestellte Zahlzeichen Sinnbild einer Zahlenart ist –, das hängt vom Wirtschaftsstil der einzelnen Kulturen ab, die jedesmal eine andere Art von Geld hervorbringen. Diese Geldart ist vorhanden nur infolge des Vorhandenseins einer städtischen Bevölkerung, die in ihr wirtschaftlich denkt, und sie bestimmt weiterhin, ob das Wertzeichen zugleich als Zahlungsmittel dient wie die antike Münze aus Edelmetall und vielleicht die babylonischen Silbergewichte. Dagegen ist der ägyptische deben, das nach Pfunden abgewogene Rohkupfer, ein Tauschmaß, aber weder Zeichen noch Zahlungsmittel, die abendländische und die »gleichzeitige« chinesische Banknote Jene in sehr bescheidenem Maße seit Ende des 18. Jahrhunderts durch die Bank von England eingeführt, diese zur Zeit der kämpfenden Staaten. ein Mittel, aber kein Maß, und über die Rolle, welche Münzen aus Edelmetall in unserer Art von Wirtschaft spielen, pflegen wir uns vollkommen zu täuschen: sie sind eine in Nachahmung der antiken Sitte hergestellte Ware und besitzen deshalb, am Buchwert des Kreditgeldes gemessen, einen Kurs.
Aus dieser Art von Denken heraus wird der mit dem Leben und dem Boden verbundene Besitz zum Vermögen, das dem Wesen nach beweglich und qualitativ unbestimmt ist: es besteht nicht in Gütern, sondern es wird in solchen »angelegt«. An sich betrachtet ist es ein rein zahlenmäßiges Quantum von Geldwert. Die »Höhe« des Vermögens, was man mit dem »Umfang« eines Güterbesitzes vergleiche.
Als Sitz dieses Denkens wird die Stadt zum Geldmarkt (Geldplatz) und Wertmittelpunkt, und ein Strom von Geldwerten beginnt den Güterstrom zu durchdringen, zu durchgeistigen und zu beherrschen. Aber damit erhebt sich der Händler vom Organ zum Herrn des Wirtschaftslebens. Denken in Geld ist immer irgendwie kaufmännisches, » geschäftliches« Denken. Es setzt die erzeugende Wirtschaft des Landes voraus und ist deshalb zunächst immer erobernd, denn es gibt nichts Drittes. Die Worte Erwerb, Gewinn, Spekulation deuten auf einen Vorteil, welcher den zum Verbraucher wandernden Dingen unterwegs abgelistet wird, auf intellektuelle Beute, und sind deshalb auf das frühe Bauerntum nicht anwendbar. Man muß sich ganz in den Geist und Wirtschaftsblick des echten Städters versetzen. Er arbeitet nicht für den Bedarf, sondern für den Verkauf, »für Geld«.
Die geschäftliche Auffassung durchdringt allmählich jede Art von Tätigkeit. Mit dem Güterverkehr innerlich verbunden war der ländliche Mensch Geber und Nehmer zugleich; auch der Händler auf dem frühen Markte macht kaum eine Ausnahme. Mit dem Geldverkehr erscheint zwischen Erzeuger und Verbraucher wie zwischen zwei getrennten Welten » der Dritte«, dessen Denken das Geschäftsleben alsbald beherrscht. Er zwingt den ersten zum Angebot, den zweiten zur Nachfrage an ihn; er erhebt die Vermittlung zum Monopol und dann zur Hauptsache im Wirtschaftsleben, und zwingt die beiden andern, in seinem Interesse in Form zu sein, die Ware nach seiner Berechnung herzustellen und unter dem Druck seiner Angebote abzunehmen.
Wer dieses Denken beherrscht, ist Meister des Geldes. Bis zu den modernen Piraten des Geldmarktes, welche die Vermittlung vermitteln und mit der Ware »Geld« [siehe wikipedia] ein Glücksspiel treiben, wie es Zola in seinem berühmten Roman beschrieben hat.
Die Entwicklung geht in allen Kulturen diesen Weg. Lysias stellt in seiner Rede gegen die Getreidehändler fest, daß die Spekulanten im Piräus manchmal das Gerücht verbreiteten, eine Getreideflotte sei gescheitert oder ein Krieg ausgebrochen, um eine einträgliche Panik hervorzurufen. In hellenistisch-römischer Zeit war es eine verbreitete Sitte, auf Verabredung den Anbau zu beschränken oder die Einfuhr stocken zu lassen, um die Preise hinaufzutreiben. In Ägypten machte das dem abendländischen Bankverkehr vollkommen ebenbürtige Girowesen des Neuen ReichesPreisigke, Girowesen im griechischen Ägypten (1910); die damaligen Verkehrsformen standen schon unter der 18. Dynastie auf gleicher Höhe. Getreidecorner amerikanischen Stils möglich. Kleomenes, der Finanzverwalter Alexanders des Großen für Ägypten, konnte durch Buchkäufe den gesamten Getreidevorrat in seine Hand bringen, was eine Hungersnot weithin in Griechenland hervorrief und ungeheuren Gewinn abwarf. Wer wirtschaftlich anders denkt, sinkt damit zum bloßen Objekt großstädtischer Geldwirkungen herab. Dieser Stil ergreift bald das Wachsein der gesamten Stadtbevölkerung und damit aller, welche für die Lenkung der Wirtschaftsgeschichte ernsthaft in Betracht kommen. Bauer und Bürger bedeutet nicht nur den Unterschied von Land und Stadt, sondern auch den von Gut und Geld. Die prunkvolle Kultur der homerischen und provenzalischen Fürstenhöfe ist etwas, das mit dem Menschen gewachsen und verwachsen ist wie heute noch vielfach das Leben auf den Landsitzen alter Familien; die feinere Kultur des Bürgertums, der »Komfort«, ist etwas von außen Kommendes, das bezahlt werden kann.Es steht mit dem bürgerlichen Ideal der Freiheit nicht anders. In der Theorie und also auch in Verfassungen mag man grundsätzlich frei sein. Im wirklichen Privatleben der Städte ist man unabhängig nur durch das Geld. Alle hochentwickelte Wirtschaft ist Stadtwirtschaft.
Die Weltwirtschaft, diejenige aller Zivilisationen, sollte man Weltstadtwirtschaft nennen. Die Schicksale auch der Wirtschaft entscheiden sich nur noch an wenigen Punkten, den Geldplätzen, Die man auch in den übrigen Kulturen Börsenplätze nennen kann, wenn man unter Börse das Denkorgan einer vollendeten Geldwirtschaft versteht. in Babylon, Theben, Rom, in Byzanz und Bagdad, in London, New York, Berlin und Paris. Der Rest ist Provinzwirtschaft, die ihre Kreise dürftig im Kleinen zieht, ohne sich des vollen Umfangs ihrer Abhängigkeit bewußt zu sein. Geld ist zuletzt die Form von geistiger Energie, in welcher der Herrscherwille, die politische, soziale, technische, gedankliche Gestaltungskraft, die Sehnsucht nach einem Leben von großem Zuschnitt zusammengefaßt sind. Shaw hat vollkommen recht: »Die allgemeine Achtung vor dem Gelde ist die einzige hoffnungsvolle Tatsache in unserer Zivilisation ... Geld und Leben sind unzertrennlich ... Geld ist das Leben.« Vorwort zu »Major Barbara«. Zivilisation bezeichnet also die Stufe einer Kultur, auf welcher Tradition und Persönlichkeit ihre unmittelbare Geltung verloren haben und jede Idee zunächst in Geld umgedacht werden muß, um verwirklicht zu werden. Am Anfang war man begütert, weil man mächtig war. Jetzt ist man mächtig, weil man Geld hat. Erst das Geld erhebt den Geist auf den Thron. Demokratie ist die vollendete Gleichsetzung von Geld und politischer Macht.
Es geht ein Verzweiflungskampf durch die Wirtschaftsgeschichte jeder Kultur, den die im Boden wurzelnde Tradition einer Rasse, ihre Seele, gegen den Geist des Geldes führt. Die Bauernkriege zu Beginn einer Spätzeit – in der Antike 700–500, bei uns 1450–1650, in Ägypten am Ausgang des Alten Reiches – sind die erste Auflehnung des Blutes gegen das Geld, das von den mächtig werdenden Städten her seine Hand nach dem Boden ausstreckt.Vgl. Bd. II, S. 984.
Die Warnung des Freiherrn vom Stein: »Wer den Boden mobilisiert, löst ihn in Staub auf«, deutet auf eine Gefahr jeder Kultur; kann das Geld den Besitz nicht angreifen, so dringt es in das bäuerliche und adlige Denken selbst ein; der ererbte, mit dem Geschlecht verwachsene Besitz erscheint dann als Vermögen, das in Grund und Boden nur angelegt und an und für sich beweglich ist. Der »Farmer« ist der Mensch, den nur noch praktische Beziehung mit einem Stück Land verbindet. Das Geld erstrebt die Mobilisierung aller Dinge. Weltwirtschaft ist die zur Tatsache gewordene Wirtschaft in abstrakten, vom Boden völlig fortgedachten, verflüssigten Werten. Die zunehmende Intensität dieses Denkens erscheint im Wirtschaftsbilde als Wachstum der vorhandenen Geldmasse, die als etwas ganz abstraktes und eingebildetes mit dem sichtbaren Vorrat von Gold als einer Ware gar nichts zu tun hat. Die »Versteifung des Geldmarktes« z. B. ist ein rein geistiger Vorgang, der sich in den Köpfen einer ganz kleinen Zahl von Menschen abspielt. Die steigende Energie des Gelddenkens erweckt deshalb in allen Kulturen das Gefühl, daß der »Geldwert sinkt«, in gewaltigem Maße z. B. von Solon bis Alexander, nämlich im Verhältnis zur Rechnungseinheit. In Wirklichkeit sind die geschäftlichen Werteinheiten etwas Künstliches geworden und mit den erlebten Urwerten der bäuerlichen Wirtschaft gar nicht mehr vergleichbar. Es ist zuletzt gleichgültig, mit was für Zahlen beim attischen Bundesschatz auf Delos (454), bei den karthagischen Friedensschlüssen (241, 201) und dann bei der Beute des Pompejus (64) gerechnet wird und ob wir in einigen Jahrzehnten von den um 1850 noch unbekannten und uns heute ganz geläufigen Milliarden zu Billionen übergehen werden. Es fehlt an jedem Maßstab, um etwa den Wert eines Talents in den Jahren 430 und 30 zu vergleichen, denn das Gold wie das Vieh und Getreide haben nicht nur ihren Ziffernwert, sondern auch ihre Bedeutung innerhalb der vorschreitenden Stadtwirtschaft fortgesetzt verändert. Es bleibt nur die Tatsache, daß die Geldmenge, welche mit dem Bestand an Wertzeichen und Zahlungsmitteln nicht verwechselt werden darf, ein alter ego des Denkens ist.
Das antike Gelddenken hat seit den Tagen Hannibals ganze Städte in Münze, ganze Völkerschaften in Sklaven verwandelt und damit in Geld, das sich von allen Seiten nach Rom bewegt, um dort als Macht zu wirken. Das faustische Gelddenken »erschließt« ganze Kontinente, die Wasserkräfte riesenhafter Stromgebiete, die Muskelkraft der Bevölkerung weiter Landschaften, Kohlenlager, Urwälder, Naturgesetze und wandelt sie in finanzielle Energie um, die irgendwo in Gestalt der Presse, der Wahlen, der Budgets und Heere angesetzt wird, um Herrscherpläne zu verwirklichen. Immer neue Werte werden aus dem geschäftlich noch indifferenten Weltbestand abgezogen, »des Goldes schlummernde Geister«, wie John Gabriel Borkmann sagt; was die Dinge abgesehen davon noch sind, kommt wirtschaftlich nicht in Betracht.
4
Jede Kultur besitzt, wie ihre eigne Art in Geld zu denken, so auch ihr eignes Symbol des Geldes, durch das sie ihr Prinzip der Wertung im Wirtschaftsbilde sichtbar zum Ausdruck bringt. Dies Etwas, eine Versinnlichung des Gedachten, steht den für Ohr und Auge gesprochenen, geschriebenen, gezeichneten Ziffern, Figuren und andern Symbolen der Mathematik an Bedeutung völlig gleich, ein tiefes und reiches Gebiet, das noch fast unerforscht daliegt. Nicht einmal die Grundfragen sind richtig gestellt worden. Es ist deshalb heute noch ganz unmöglich, die Geldidee zu umschreiben, welche dem ägyptischen Naturalien- und Geldgiroverkehr, dem babylonischen Bankwesen, der chinesischen Buchführung und dem Kapitalismus der Juden, Parsen, Griechen, Araber seit Harun al Raschid zugrunde liegt. Möglich ist nur eine Gegenüberstellung des apollinischen und faustischen Geldes, des Geldes als Größe und des Geldes als Funktion. Zum folgenden vgl. Bd. I, Kap. I.
Dem antiken Menschen erscheint auch wirtschaftlich die Umwelt als Summe von Körpern, die ihren Ort wechseln, wandern, sich drängen, stoßen, vernichten, so wie es Demokrit von der Natur beschreibt. Der Mensch ist Körper unter Körpern. Die Polis ist als Summe davon ein Körper höherer Ordnung. Der gesamte Lebensbedarf besteht aus körperlichen Größen. Also stellt auch ein Körper das Geld dar, so wie eine Apollostatue die Gottheit darstellt. Um 650 ist, gleichzeitig mit dem Steinkörper des dorischen Tempels und der allseitig frei durchgebildeten Statue auch die Münze entstanden, ein Metallgewicht von schön geprägter Form. Der Wert als Größe war längst vorhanden und ist so alt wie diese Kultur überhaupt. Bei Homer wird unter Talent eine kleine Menge goldener Geräte und Schmucksachen von bestimmtem Gesamtgewicht verstanden. Auf dem Schilde des Achill sind »zwei Talente« abgebildet, und noch zur Römerzeit war die Gewichtsangabe auf Silber- und Goldgefäßen allgemein üblich.Friedländer, Röm. Sittengesch. IV (1921), S. 301.
Die Erfindung des klassisch geformten Geldkörpers aber ist so außerordentlich, daß wir seine tiefe, rein antike Bedeutung noch gar nicht begriffen haben. Wir halten ihn für eine jener berühmten »Errungenschaften der Menschheit«. Allenthalben werden seitdem Münzen geprägt, so wie überall Statuen auf Straßen und Plätzen herumstehen. So weit reicht unsere Macht. Wir können die Gestalt nachahmen, aber ihr die gleiche wirtschaftliche Bedeutung geben können wir nicht. Die Münze als Geld ist eine rein antike Erscheinung und nur in einer ganz euklidisch gedachten Umgebung möglich; hier hat sie aber auch das gesamte Wirtschaftsleben gestaltend beherrscht. Begriffe wie Einkommen, Vermögen, Schuld, Kapital bedeuten in antiken Städten etwas ganz anderes als bei uns, weil nicht wirtschaftliche Energie damit gemeint ist, die von einem Punkte ausstrahlt, sondern eine Summe von Wertgegenständen, die sich in einer Hand befinden. Vermögen ist immer ein beweglicher Barvorrat, der durch Addition und Subtraktion von Wertsachen verändert wird und mit Grundbesitz gar nichts zu tun hat. Beide sind im antiken Denken völlig getrennt. Kredit besteht im Leihen von Bargeld in der Erwartung, daß es als solches wieder zurückgegeben werden kann. Catilina war arm, weil er trotz seiner großen GüterSallust, Catilina 35, 3. niemand fand, der ihm zu politischen Zwecken Bargeld anvertraute, und die ungeheuren Schulden römischer Politiker Vgl. Bd. II, S. 1134. haben nicht einen entsprechenden Grundbesitz zur Unterlage, sondern die bestimmte Aussicht auf eine Provinz, deren bewegliche Sachwerte ausgebeutet werden konnten.Wie schwer es dem antiken Menschen war, sich den Umsatz einer körperlich nicht allseitig abgegrenzten Sache wie Grund und Boden in körperliches Geld vorzustellen, zeigen die Steinpfähle (όροι) auf griechischen Grundstücken, welche die Hypothek darstellen sollten, und der römische Kauf per aes et libram, wobei gegen eine Münze eine Erdscholle vor Zeugen überreicht wurde. Einen wirklichen Güterhandel hat es infolgedessen nie gegeben, und ebensowenig etwas wie Tagespreise für Ackerland. Ein regelmäßiges Verhältnis zwischen Bodenwert und Geldwert ist im antiken Denken ebenso unmöglich wie ein solches zwischen Kunstwert und Geldwert. Geistige, also unkörperliche Erzeugnisse wie Dramen oder Fresken besaßen wirtschaftlich überhaupt keinen Wert. Über den antiken Rechtsbegriff der Sache vgl. Bd. II, S. 653.
Erst das Denken in körperlichem Geld macht eine Reihe von Erscheinungen begreiflich: die Massenhinrichtung von Reichen unter der zweiten Tyrannis und die römischen Proskriptionen, um einen größeren Teil der umlaufenden Bargeldmasse in die Hand zu bekommen, das Einschmelzen der delphischen Tempelschätze durch die Phoker im Heiligen Kriege, der Kunstschätze von Korinth durch Mummius, der letzten römischen Weihgeschenke durch Cäsar, der griechischen durch Sulla, der kleinasiatischen durch Brutus und Cassius, ohne Rücksicht auf den Kunstwert, weil man die edlen Stoffe, Metalle und Elfenbein, brauchte. Schon zur Zeit des Augustus kann von den antiken Kunstwerken aus Edelmetall und Bronze nicht viel übrig gewesen sein. Selbst der gebildete Athener dachte viel zu unhistorisch, um eine Statue aus Gold und Elfenbein nur deshalb zu schonen, weil sie von Phidias war. Man erinnere sich, daß an dessen berühmter Athenefigur die Goldteile abnehmbar angefertigt waren und von Zeit zu Zeit nachgewogen wurden. Die wirtschaftliche Verwendung war also von vornherein ins Auge gefaßt. Was bei den Triumphen an Statuen und Gefäßen aufgeführt wurde, war in den Augen der Zuschauer bares Geld, und Mommsen konnte den Versuch machen, Ges. Schriften IV, 200 ff. den Ort der Varusschlacht nach Münzfunden zu bestimmen, weil der römische Veteran sein ganzes Vermögen in Edelmetall auf dem Körper trug. Antiker Reichtum ist kein Guthaben, sondern ein Geldhaufen; ein antiker Geldplatz ist nicht Mittelpunkt des Kredits wie die heutigen Börsenplätze und das ägyptische Theben, sondern eine Stadt, in welcher sich ein erheblicher Teil des Bargeldbestandes der Welt gesammelt hat. Man darf annehmen, daß zur Zeit Cäsars weit über die Hälfte des antiken Goldes sich jederzeit in Rom befand.
Aber als diese Welt in das Zeitalter der unbedingten Geldherrschaft getreten war, etwa seit Hannibal, reichte die natürlich begrenzte Masse von Edelmetall und stofflich wertvollen Kunstwerken innerhalb ihres Machtgebietes nicht mehr aus, um den Bedarf an Barmitteln zu decken, und es entstand ein wahrer Heißhunger nach neuen geldfähigen Körpern. Da fiel der Blick auf den Sklaven, der eine andere Art von Körper, aber nicht Person sondern Sache war Vgl. Bd. II, S. 625. und deshalb als Geld gedacht werden konnte. Erst von da an wird der antike Sklave etwas Einzigartiges in der gesamten Wirtschaftsgeschichte. Die Eigenschaften der Münze haben sich auf lebendige Objekte ausgedehnt, und damit tritt neben den Metallbestand der durch die Plünderungen von Statthaltern und Steuerpächtern wirtschaftlich »erschlossenen« Gebiete deren Menschenbestand. Es entwickelt sich eine bizarre Art von Doppelwährung. Der Sklave hat einen Kurs, was vom Grund und Boden nicht gilt. Er dient zur Anhäufung großer Barvermögen, und erst infolge davon erscheinen jene ungeheuren Sklavenmassen der Römerzeit, die aus einem andern Bedarf gar nicht zu erklären sind. Solange man nur soviel Sklaven hielt, als man gewerblich brauchte, war ihre Zahl gering und aus Kriegsbeute und Schuldknechtschaft leicht zu decken.Der Glaube, daß die Sklaven selbst in Athen oder Ägina jemals auch nur ein Drittel der Bevölkerung ausgemacht hätten, ist vollkommen sinnlos. Die Revolutionen seit 400 (Bd. II, S. 1066) setzen im Gegenteil eine gewaltige Überzahl der freien Armen voraus. Erst im 6. Jahrhundert hat Chios mit der Einfuhr gekaufter Sklaven (Argyroneten) den Anfang gemacht. Ihr Unterschied gegen die viel zahlreicheren Lohnarbeiter war zunächst politisch-rechtlicher und nicht wirtschaftlicher Natur.
Da die antike Wirtschaft statisch und nicht dynamisch ist und die planmäßige Erschließung von Energiequellen nicht kennt, so waren die Sklaven der Römerzeit nicht da, um ausgebeutet zu werden, sondern sie wurden beschäftigt, so gut es ging, um in möglichst großer Zahl gehalten werden zu können. Man bevorzugte Prunksklaven, die sich auf irgend etwas verstanden, weil sie bei gleichem Unterhalt einen höheren Wert darstellten; man vermietete sie, wie man bares Geld auslieh; man ließ sie Geschäfte auf eigene Rechnung treiben, so daß sie reich werden konnten; Vgl. Bd. II, S. 1160. man unterbot mit ihnen die freie Arbeit, alles nur, um wenigstens die Erhaltungskosten dieses Kapitals zu decken.Das ist der Gegensatz zur Negersklaverei unserer Barockzeit, die eine Vorstufe der Maschinenindustrie darstellt: eine Organisation von »lebendiger« Energie, bei welcher man vom Menschen endlich zur Kohle überging, und das erste erst dann als unmoralisch empfand, als das zweite eingebürgert war. Von dieser Seite betrachtet, bedeutet der Sieg des Nordens im amerikanischen Bürgerkrieg (1865) den wirtschaftlichen Sieg der konzentrierten Energie der Kohle über die einfache Energie der Muskeln.
Die Mehrzahl konnte gar nicht voll beschäftigt werden. Sie erfüllten ihren Zweck, indem sie einfach da waren, als ein Geldvorrat, den man zur Hand hatte und dessen Umfang nicht an die natürlichen Grenzen der damals vorhandenen Goldmenge gebunden war. Und damit stieg allerdings der Sklavenbedarf ins Ungemessene und führte über Kriege, die nur der Sklavenbeute wegen unternommen wurden, hinaus zu Sklavenjagden von Privatunternehmern längs allen Küsten des Mittelmeeres, die von Rom geduldet wurden, und zu einer neuen Art, Vermögen zu machen, indem man als Statthalter die Bevölkerung ganzer Landstriche aussog und dann in die Schuldknechtschaft verkaufte. Auf dem Markt von Delos sollen an einem Tage zehntausend Sklaven verkauft worden sein. Als Cäsar nach Britannien ging, wurde die Enttäuschung in Rom über die Goldarmut des Volkes durch die Aussichten auf reiche Sklavenbeute aufgewogen. Für antikes Denken war es ein und dieselbe Operation, wenn etwa bei der Zerstörung von Korinth die Statuen ausgemünzt und die Einwohner auf den Sklavenmarkt gebracht wurden: in beiden Fällen hatte man körperliche Gegenstände in Geld verwandelt.
Den äußersten Gegensatz dazu bildet das Symbol des faustischen Geldes, des Geldes als Funktion, als Kraft, dessen Wert in seiner Wirkung, nicht in seinem bloßen Dasein liegt. Der neue Stil dieses Wirtschaftsdenkens erscheint schon in der Art, wie die Normannen um 1000 ihre Beute an Land und Leuten zu einer wirtschaftlichen Macht organisierten.Vgl. Bd. II, S. 1019f. Die Verwandtschaft mit der ägyptischen Verwaltung des Alten Reiches und der chinesischen der frühesten Dschouzeit ist unverkennbar. Man vergleiche den reinen Buchwert im Rechnungswesen ihrer Herzöge, aus dem die Worte Scheck, Konto und Kontrolle stammen, Die clerici in diesen Rechnungskammern sind das Urbild der modernen Bankbeamten (engl, clerk). mit den gleichzeitigen »Talenten Goldes« der Ilias, und man erhält gleich am Anfang den Begriff des modernen Kredits, der aus dem Vertrauen auf die Kraft und Dauer einer Wirtschaftsführung hervorgeht und mit der Idee unseres Geldes beinahe identisch ist. Diese durch Roger II. auf das sizilische Normannenreich übertragene Finanzmethode hat der Hohenstaufe Friedrich II. um 1230 zu einem gewaltigen System ausgebaut, das in seiner Dynamik weit über das Vorbild hinausging und ihn »zur ersten Kapitalkraft der Welt« [Hampe, Deutsche Kaisergesch., S. 246. Leonardo Pisano, dessen Liber Abaci (1202) für das kaufmännische Rechnen weit über die Renaissance hinaus maßgebend war, und der außer dem arabischen Ziffernsystem auch die negativen Zahlen als Debitum eingeführt hat, wurde von dem großen Hohenstaufen gefördert.] machte. Und während diese Verschwisterung von mathematischer Denkkraft und königlichem Machtwillen von der Normandie nach Frankreich eindrang und 1066 auf das erbeutete England in großartigem Maßstab angewandt wurde – der englische Boden ist heute noch dem Namen nach königliche Domäne –, wurde sie in Sizilien von den italienischen Städterepubliken nachgeahmt, deren regierende Patrizier sie bald vom Gemeindehaushalt auf ihre eigenen Handelsbücher und damit auf das kaufmännische Denken und Rechnen der ganzen abendländischen Welt übertrugen. Wenig später wurde die sizilische Praxis auch vom Deutschritterorden und der aragonischen Dynastie übernommen, worauf sich vielleicht das mustergültige Rechnungswesen Spaniens unter Philipp II. und Preußens unter Friedrich Wilhelm I. zurückführen läßt.
Entscheidend aber wurde, »gleichzeitig« mit der Erfindung der antiken Münze um 650, die der doppelten Buchführung durch Fra Luca Pacioli (1494). »Es ist eine der schönsten Erfindungen des menschlichen Geistes«, heißt es in Goethes Wilhelm Meister. In der Tat darf sich ihr Urheber seinen Zeitgenossen Kolumbus und Kopernikus ohne Scheu zur Seite stellen. Den Normannen verdanken wir die Kontenrechnung, den Lombarden diese Buchführung. Es sind die germanischen Stämme, welche die beiden verheißungsvollsten Rechtswerke der frühen Gotik geschaffen haben [Vgl. Bd. II, S. 645 f.] und von deren Sehnsucht nach fernen Meeren die beiden Entdeckungen Amerikas ihren Anstoß erhielten. »Die doppelte Buchhaltung ist aus demselben Geiste geboren wie die Systeme Galileis und Newtons. ... Mit denselben Mitteln wie diese ordnet sie die Erscheinungen zu einem kunstvollen System, und man kann sie als den ersten auf dem Grundsatz des mechanischen Denkens aufgebauten Kosmos bezeichnen. Die doppelte Buchhaltung erschließt uns den Kosmos der wirtschaftlichen Welt nach derselben Methode wie später die großen Naturforscher den Kosmos der Sternenwelt. ... Die doppelte Buchhaltung ruht auf dem folgerichtig durchgeführten Grundgedanken, alle Erscheinungen nur als Quantitäten zu erfassen.« Sombart, Der moderne Kapitalismus II, S. 119.
Die doppelte Buchführung ist eine reine Analysis des Wertraums, bezogen auf ein Koordinatensystem, dessen Anfangspunkt »die Firma« ist. Die antike Münze hatte nur ein arithmetisches Rechnen mit Wert größen gestattet. Wiederum stehen sich Pythagoras und Descartes gegenüber. Man darf von der Integration eines Unternehmens sprechen, und die graphische Kurve ist in der Wirtschaft wie der Wissenschaft das gleiche optische Hilfsmittel. Die antike Wirtschaftswelt gliedert sich wie der Kosmos Demokrits nach Stoff und Form. Ein Stoff in der Form der Münze ist Träger der wirtschaftlichen Bewegung und drängt die Bedarfsgrößen von gleichem Wertquantum an den Ort ihrer Verwendung. Unsere Wirtschaftswelt gliedert sich nach Kraft und Masse. Ein Kraftfeld von Geldspannungen liegt im Raume und erteilt jedem Objekt, unter Absehen von dessen besonderer Art, einen positiven oder negativen Wirkungswert, [Eng verwandt mit unserm Bilde vom Wesen der Elektrizität ist der Vorgang des Clearing, bei dem der positive oder negative Geldstand mehrerer Firmen (Spannungszentren) untereinander durch einen reinen Denkakt ausgeglichen und der wahre Stand durch eine Buchung versinnbildlicht wird. Vgl. Bd. I, Kap. VI.] der durch einen Bucheintrag dargestellt wird. »Quod non est in libris, non est in mundo.« Aber das Sinnbild des hier gedachten funktionalen Geldes, das was allein mit der antiken Münze verglichen werden darf, ist nicht der Buchvermerk und auch nicht der Wechsel, Scheck oder die Banknote, sondern der Akt, durch welchen die Funktion schriftlich vollzogen wird und als dessen bloßes geschichtliches Zeugnis das Wertpapier im weitesten Sinne zu gelten hat.
Aber daneben hat das Abendland in starrer Bewunderung der Antike Münzen geprägt, nicht nur als Hoheitszeichen, sondern in dem Glauben, daß das bewiesenes Geld sei, dem Wirtschaftsdenken wirklich entsprechendes Geld. Ganz ebenso ist schon in gotischer Zeit das römische Recht übernommen worden mit seiner Gleichsetzung von Sache und körperlicher Größe, und die euklidische Mathematik, die auf dem Begriff der Zahl als Größe aufgebaut war. So kam es, daß die Entwicklung dieser drei geistigen Formenwelten sich nicht wie die der faustischen Musik in rein aufblühender Entfaltung vollzog, sondern in Gestalt einer fortschreitenden Emanzipation vom Größenbegriff. Die Mathematik ist bereits mit dem Ausgang des Barock zum Ziele gelangt. Bd. I, Kap. 1. Die Rechtswissenschaft hat ihre eigentliche Aufgabe bis jetzt noch nicht einmal erkannt, Vgl. Bd. II, S. 655. aber sie ist diesem Jahrhundert gestellt, und zwar fordert sie, was für den römischen Juristen selbstverständlich war, die innere Kongruenz von Wirtschaftsdenken und Rechtsdenken und die gleiche Vertrautheit mit beiden. Der durch die Münze symbolisierte Geldbegriff deckt sich vollkommen mit dem Geist des antiken Sachenrechts; für uns ist das nicht im entferntesten der Fall. Unser gesamtes Leben ist dynamisch angelegt, nicht statisch und stoisch; deshalb sind Kräfte, Leistungen, Beziehungen, Fähigkeiten – Organisationstalent, Erfindergeist, Kredit, Ideen, Methoden, Energiequellen – das Wesentliche, und nicht das bloße Dasein körperlicher Sachen. Das »römische« Sachdenken unsrer Juristen ist deshalb ebenso lebensfremd wie eine Geldtheorie, die bewußt oder unbewußt vom Geldstück ausgeht. Der gewaltige Münzbestand, der in Nachahmung der Antike bis zum Ausbruch des Weltkriegs stets vermehrt worden ist, hat sich zwar eine Rolle abseits vom Wege geschaffen, aber mit der inneren Form der modernen Wirtschaft, ihren Aufgaben und Zielen hat er nichts zu tun, und sollte er infolge des Krieges endgültig aus dem Verkehr verschwinden, so würde damit nichts verändert sein.
[Der Kredit eines Landes beruht in unsrer Kultur auf seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und deren politischer Organisation, welche den Finanzoperationen und Buchungen den Charakter wirklicher Geldschöpfungen gibt, und nicht auf einer irgendwo eingelagerten Goldmenge. Erst der antikisierende Aberglaube erhebt die Goldreserve zum wirklichen Kreditmesser, weil ihre Höhe nun nicht mehr vom Wollen, sondern vom Können abhängt. Die umlaufenden Münzen aber sind eine Ware, die im Verhältnis zum Landeskredit einen Kurs besitzt – je schlechter der Kredit, desto höher steht das Gold, bis zu dem Punkte, wo es unbezahlbar wird und aus dem Verkehr verschwindet, so daß man es nur noch gegen andere Waren erhalten kann; das Gold wird also wie jede Ware an der buchmäßigen Rechnungseinheit gemessen, nicht umgekehrt, wie es das Wort Goldwährung andeutet – und bei kleinen Zahlungen als Mittel dient, wie gelegentlich die Briefmarke auch. In Ägypten, dessen Gelddenken dem abendländischen erstaunlich ähnlich ist, hat es auch im Neuen Reiche nichts der Münze irgendwie Ähnliches gegeben. Die schriftliche Überweisung genügte vollkommen, und von 650 an bis zur Hellenisierung durch die Gründung von Alexandria wurden die ins Land kommenden antiken Münzen in der Regel zerhackt und als Ware nach Gewicht verrechnet.]
Unglücklicherweise entstand die moderne Nationalökonomie im Zeitalter des Klassizismus, wo nicht nur Statuen, Vasen und steife Dramen als die allein wahre Kunst galten, sondern auch schön geprägte Münzen als das allein wahre Geld. Was Wedgwood seit 1768 mit seinen zartgetönten Reliefs und Tassen, das erstrebte im Grunde Adam Smith eben damals mit seiner Werttheorie: die reine Gegenwart greifbarer Größen. Denn es entspricht durchaus der Verwechslung von Geld und Geldstück, wenn der Wert einer Sache an der Größe einer Arbeitsmenge gemessen wird. Da ist »Arbeit« nicht mehr ein Wirken innerhalb einer Welt von Wirkungen, das Arbeiten, das dem inneren Range, der Intensität und der Tragweite nach unendlich verschieden ist, in immer weiteren Kreisen fortwirkt und wie ein elektrisches Kraftfeld gemessen, aber nicht abgegrenzt werden kann, sondern das ganz stofflich vorgestellte Resultat davon, das Gearbeitete, ein greifbares Etwas, an dem nichts bemerkenswert erscheint als eben der Umfang.
Aber die Wirtschaft der europäisch-amerikanischen Zivilisation ist ganz im Gegenteil auf einer Arbeit aufgebaut, die einzig durch ihren inneren Rang gekennzeichnet ist, mehr als jemals in China und Ägypten, um von der Antike zu schweigen. Wir leben nicht umsonst in einer Welt wirtschaftlicher Dynamik: die Arbeit der Einzelnen wird nicht euklidisch addiert, sondern steht in funktionaler Beziehung zueinander. Die lediglich ausführende Arbeit, von der Marx allein Kenntnis nimmt, ist nichts als die Funktion einer erfindenden, anordnenden, organisierenden Arbeit, die der andern erst Sinn, relativen Wert und die Möglichkeiten gibt, überhaupt getan zu werden. Die ganze Weltwirtschaft seit Erfindung der Dampfmaschine ist die Schöpfung einer ganz kleinen Zahl überlegener Köpfe, ohne deren hochwertige Arbeit alles andere nicht da wäre, aber diese Leistung ist schöpferisches Denken und kein »Quantum«, [Und für unser Sachenrecht also bis jetzt nicht vorhanden.] und ihr Gegenwert besteht also auch nicht in einer Anzahl von Geldstücken, sondern sie ist Geld, faustisches Geld nämlich, das nicht geprägt, sondern als Wirkungszentrum gedacht wird aus einem Leben heraus, dessen innerer Rang den Gedanken zur Bedeutung einer Tatsache erhebt.
Denken in Geld erzeugt Geld: das ist das Geheimnis der Weltwirtschaft.
Wenn ein Organisator großen Stils eine Million auf ein Papier schreibt, so ist sie da, denn seine Persönlichkeit als Wirtschaftszentrum bürgt für eine entsprechende Erhöhung der Wirtschaftsenergie seines Gebietes. Das und nichts anderes bedeutet für uns das Wort Kredit. Aber alle Goldstücke der Welt würden nicht ausreichen, der Tätigkeit des Handarbeiters einen Sinn und damit Geldwert zu geben, wenn mit der berühmten »Expropriation der Expropriateure« die überlegenen Fähigkeiten aus ihren Schöpfungen beseitigt und diese damit entseelt, willenlos, zu leeren Gehäusen würden. Darin ist Marx Klassizist wie Adam Smith und ein echtes Produkt des römischen Rechtsdenkens: er sieht nur die fertige Größe, nicht die Funktion. Er möchte die Produktionsmittel von denen trennen, deren Geist durch Erfindung von Methoden, Organisation von leistungsfähigen Betrieben, Eroberung von Absatzgebieten aus einem Haufen Stahl und Mauerwerk erst eine Fabrik macht, und die ausbleiben, wenn ihre Kraft keinen Spielraum findet. [Gesetzt den Fall, daß Arbeiter die Führung der Werke übernehmen, so würde damit nichts geändert. Entweder sie können nichts: dann geht alles zugrunde; oder sie können etwas: dann werden sie innerlich selbst Unternehmer und denken nur noch an die Behauptung ihrer Macht. Keine Theorie schafft diese Tatsache aus der Welt; so ist das Leben.]
Wer eine Theorie der modernen Arbeit geben will, der denke an diesen Grundzug alles Lebens; es gibt Subjekte und Objekte jeder Art von Lebensführung, und der Unterschied ist um so ausgeprägter, je bedeutender, je formvoller das Leben ist. Jeder Strom von Dasein besteht aus einer Minderheit von Führern und einer gewaltigen Mehrheit von Geführten, jede Art von Wirtschaft also aus Führerarbeit und ausführender Arbeit. Aus der Froschperspektive von Marx und den sozialethischen Ideologen überhaupt wird nur die letzte, kleine, massenhafte sichtbar, aber sie ist nur vermöge der ersten da, und der Geist dieser Welt von Arbeit kann nur von den höchsten Möglichkeiten aus erfaßt werden. Der Erfinder der Dampfmaschine ist maßgebend, nicht der Heizer. Auf das Denken kommt es an.
Und ebenso gibt es Subjekte und Objekte des Denkens in Geld: solche, die es kraft ihrer Persönlichkeit erzeugen und lenken, und solche, die von ihm erhalten werden. Das Geld faustischen Stils ist die aus der Wirtschaftsdynamik faustischen Stils abgezogene Kraft, und es gehört zum Schicksal des Einzelnen – zur Wirtschaftsseite seines Lebensschicksals –, ob er durch den inneren Rang seiner Persönlichkeit einen Teil dieser Kraft darstellt oder ihr gegenüber nichts als Masse ist.
5
Das Wort Kapital bezeichnet den Mittelpunkt dieses Denkens, nicht den Inbegriff dieser Werte, sondern das, was sie als solche in Bewegung hält. Kapitalismus gibt es erst mit dem weltstädtischen Dasein einer Zivilisation, und er beschränkt sich auf den ganz kleinen Kreis derer, welche dies Dasein durch ihre Person und Intelligenz darstellen. Der Gegensatz dazu ist Provinzwirtschaft. Erst die unbedingte Herrschaft der Geldmünze über das antike Leben, auch dessen politische Seite, erzeugt das statische Kapital, die ?öïñìÞ, den »Ausgangspunkt«, der durch sein Vorhandensein immer neue Massen von Dingen mit einer Art von Magnetismus an sich zieht. Erst die Herrschaft der Buchwerte, deren abstraktes System durch die doppelte Buchführung von der Persönlichkeit gleichsam abgelöst ist und mit eigener innerer Dynamik fortarbeitet, hat das moderne Kapital hervorgebracht, dessen Kraftfeld die Erde umspannt.
[Erst seit 1770 also werden die Banken als Kreditmittelpunkte eine wirtschaftliche Macht, die auf dem Wiener Kongreß zum erstenmal in die Politik eingreift. Bis dahin besorgte der Bankier vorwiegend Wechselgeschäfte. Die chinesischen und selbst die ägyptischen Banken haben eine andere Bedeutung, und die antiken Banken auch im cäsarischen Rom sollte man besser Kassen nennen. Sie sammelten Steuererträge in Bargeld ein und liehen Bargeld gegen Wiedererstattung aus; so werden die Tempel mit ihrem Metallvorrat an Weihgeschenken zu »Banken«. Der Tempel von Delos lieh jahrhundertelang zu 10% aus.]
Unter der Einwirkung des antiken Kapitals nimmt das Wirtschaftsleben die Form eines Goldstroms an, der von den Provinzen nach Rom und zurück fließt und der immer neue Gebiete sucht, deren Bestände an verarbeitetem Gold noch nicht »erschlossen« sind. Brutus und Cassius führten das Gold der kleinasiatischen Tempel in langen Maultierkolonnen auf das Schlachtfeld von Philippi – man begreift, was für eine Wirtschaftsoperation die Plünderung eines Lagers nach der Schlacht sein konnte –, und schon C. Gracchus wies darauf hin, daß die mit Wein gefüllten Amphoren, die von Rom in die Provinzen gingen, mit Gold gefüllt zurückkehrten. Dieser Zug nach dem Goldbesitz fremder Völker entspricht durchaus dem heutigen Zug zur Kohle, die im tieferen Sinn keine »Sache«, sondern ein Schatz von Energie ist.
Es entspricht aber auch dem antiken Hang zur Nähe und Gegenwart, wenn zum Ideal der Polis das Wirtschaftsideal der Autarkeia tritt. Der politischen Atomisierung der antiken Welt sollte die wirtschaftliche entsprechen. Jede dieser winzigen Lebenseinheiten wollte einen eignen und ganz in sich geschlossenen Wirtschaftsstrom haben, der unabhängig von allen andern, und zwar in Sehweite, kreiste. Den äußersten Gegensatz dazu bildet der abendländische Begriff der Firma, ein ganz unpersönlich und unkörperlich gedachtes Kraftzentrum, dessen Wirkung nach allen Seiten ins Unendliche ausstrahlt und das der »Inhaber« durch seine Fähigkeit, in Geld zu denken, nicht darstellt, sondern wie einen kleinen Kosmos besitzt und leitet, das heißt in seiner Gewalt hat. Diese Zweiheit von Firma und Inhaber wäre dem antiken Denken gänzlich unvorstellbar gewesen.
[Der Begriff der Firma war schon in spätgotischer Zeit als ratio oder negotiatio ausgebildet und läßt sich durch kein Wort einer antiken Sprache wiedergeben. Negotium bezeichnet für den Römer einen konkreten Vorgang (»ein Geschäft machen«, nicht »haben«).]
Deshalb bedeuten die abendländische und die antike Kultur ein Maximum und Minimum von Organisation, die dem antiken Menschen selbst als Begriff vollkommen gefehlt hat. Seine Finanzwirtschaft ist das zur Regel erhobene Provisorium: da werden reiche Bürger in Athen und Rom mit der Ausrüstung von Kriegsschiffen belastet; die politische Macht des römischen Ädils und seine Schulden beruhen darauf, daß er Spiele, Straßen und Gebäude nicht nur ausführt, sondern auch bezahlt, und sich später allerdings durch die Plünderung seiner Provinz wieder bezahlt machen durfte. An Einnahmequellen dachte man erst, wenn man sie brauchte, und man nahm sie ohne jedes Vorausdenken so in Anspruch, wie es der augenblickliche Bedarf forderte, auch wenn sie dadurch zerstört werden mußten. Plünderung der eignen Tempelschätze, Seeraub an Schiffen der eignen Stadt, Konfiskation von Vermögen der eignen Mitbürger waren alltägliche Finanzmethoden. Waren Überschüsse vorhanden, so wurden sie an die Bürger verteilt, ein Verfahren, dem z. B. Eubulos in Athen seinen Ruf verdankte. [Pöhlmann, Griech. Gesch. (1914), S. 216 f.]
Es gab weder einen Etat noch etwas wie Wirtschaftspolitik. Die »Bewirtschaftung« der römischen Provinzen war ein öffentlicher und privater Raubbau, der von Senatoren und Geldleuten betrieben wurde ohne Rücksicht darauf, ob und wie die abgeführten Werte wieder ergänzt werden konnten. Der antike Mensch hat nie an eine planmäßige Steigerung des Wirtschaftslebens gedacht, nur an das augenblickliche Ergebnis, das erreichbare Quantum von barem Geld. Ohne das alte Ägypten wäre das kaiserliche Rom verloren gewesen: hier lag zum Glück eine Zivilisation, die seit einem Jahrtausend an nichts gedacht hatte als an die Organisation ihrer Wirtschaft. Der Römer verstand weder diesen Lebensstil noch konnte er ihn nachahmen, [Gercke-Norden, Einl. in die Altertumswissensch. III, S. 291.] aber der Zufall, daß hier eine unerschöpfliche Quelle von Geld für den floß, welcher die politische Macht über diese Fellachenwelt besaß, hat die Erhebung der Proskriptionen zu einer Sitte unnötig gemacht. Die letzte dieser Finanzoperationen in Gestalt einer Schlächterei war die vom Jahre 43, kurze Zeit vor der Einverleibung Ägyptens. X(Kromayer in Hartmanns Röm. Gesch., S. 150.] Die Goldmasse, welche Brutus und Cassius damals aus Asien heranführten und die ein Heer und damit die Weltherrschaft bedeutete, machte die Ächtung der 2000 reichsten Bewohner Italiens nötig, deren Köpfe um der ausgesetzten Belohnung willen in Säcken auf das Forum geschleppt wurden. Man war nicht mehr in der Lage, die eignen Verwandten, Kinder und Greise, Leute, die sich nie mit Politik befaßt hatten, zu schonen, wenn sie einen Schatz an barem Gelde besaßen. Das Ergebnis wäre zu gering geworden.
Aber mit dem Hinschwinden des antiken Weltgefühls in der frühen Kaiserzeit erlischt auch diese Art des Denkens in Geld. Die Geldmünzen werden wieder zu Gütern, weil der Mensch wieder bäuerlich lebt, und so erklärt sich das ungeheure Abströmen des Goldes seit Hadrian in den fernen Osten, für das man bis jetzt keine Erklärung fand. Das Wirtschaftsleben in Gestalt eines Goldstroms war unter dem Heraufdringen einer jungen Kultur erloschen, und deshalb hat auch der Sklave aufgehört, Geld zu sein. Dem Abfluß des Goldes geht jene massenhafte Freilassung der Sklaven zur Seite, die durch keins der zahlreichen kaiserlichen Gesetze seit Augustus aufzuhalten war, und unter Diokletian, dessen berühmter Maximaltarif sich überhaupt nicht mehr auf eine Geldwirtschaft bezieht, sondern eine Tauschordnung für Güter darstellt, ist der Typus des antiken Sklaven nicht mehr vorhanden.
[Die Juden dieser Zeit waren die Römer (Bd. II, S. 951 f.). Dagegen sind die Juden damals Bauern, Handwerker, kleine Gewerbetreibende (Parván, Die Nationalität der Kaufleute im röm. Kaiserreich, 1909; ebenso Mommsen, Röm. Gesch. V, S. 471), d. h. sie üben die Berufe aus, welche in gotischer Zeit das Objekt ihrer Handelsgeschäfte geworden wären. In derselben Lage befinden sich heute »Europa gegenüber die Russen, deren ganz mystisches Innenleben das Denken in Geld als Sünde empfindet. (Der Pilger in Gorkis Nachtasyl und die ganze Gedankenwelt Tolstois, vgl. S. 792, 898.) Hier hegen heute wie in Syrien zur Zeit Jesu zwei Wirtschaftswelten übereinander (S. 788 ff.), eine obere, fremde, zivilisierte, die von Westen eingedrungen ist und zu der als Hefe der ganz abendländische und unrussische Bolschewismus der ersten Jahre gehört, und eine stadtlose, nur unter Gütern lebende in der Tiefe, die nicht rechnet, sondern ihren unmittelbaren Bedarf eintauschen möchte. Man muß die Schlagworte der Oberfläche als eine Stimme auffassen, aus welcher der ganz mit seiner Seele beschäftigte einfache Russe den Willen Gottes heraushört. Der Marxismus unter Russen beruht auf einem inbrünstigen Mißverständnis. Man hat das höhere Wirtschaftsleben des Petrinismus ertragen, aber weder geschaffen noch anerkannt. Der Russe bekämpft das Kapital nicht, sondern er begreift es nicht. Wer Dostojewski zu lesen versteht, wird hier eine junge Menschheit ahnen, für die es noch gar kein Geld gibt, nur Güter in bezug auf ein Leben, dessen Gewicht nicht auf der Wirtschaftsseite liegt. Die »Angst vor dem Mehrwert«, die vor dem Kriege manchen bis zum Selbstmord getrieben hat, ist eine unverstandene literarische Verkleidung der Tatsache, daß der Gelderwerb durch Geld für das stadtlose Güterdenken ein Frevel ist, aus der werdenden russischen Religion heraus gedacht eine Sünde. So wie heute die Städte des Zarentums verfallen und der Mensch in ihnen wieder wie im Dorfe lebt, unter der Kruste des städtisch denkenden, rasch hinschwindenden Bolschewismus, so hat er sich von der westlichen Wirtschaft befreit. Der apokalyptische Haß – der auch das einfache Judentum zur Zeit Jesu gegen Rom beherrschte – richtete sich nicht nur gegen Petersburg als Stadt, als Sitz einer politischen Macht westlichen Stils, sondern auch als Mitte eines Denkens in westlichem Geld, was das ganze Leben vergiftet und in eine falsche Bahn gelenkt hat. Das Russentum der Tiefe läßt heute eine noch priesterlose, auf dem Johannesevangelium aufgebaute dritte Art des Christentums entstehen, die der magischen unendlich viel näher steht als der faustischen, die deshalb auf einer neuen Symbolik der Taufe beruht und, weit entfernt von Rom und Wittenberg, in einer Vorahnung künftiger Kreuzzüge über Byzanz hinweg nach Jerusalem blickt. Damit allein beschäftigt, wird es sich die Wirtschaft des Westens wieder gefallen lassen, wie der Urchrist die römische, der gotische Christ die jüdische, aber es beteiligt sich innerlich nicht mehr an ihr. (Hierzu Bd. II, S. 788ff., 835, 898, 921 Anm. 1.)]
SIEHE AUCH "II Die Maschine", Abschnitt 8 über die "Diktatur des Geldes"
II. Die Maschine
6
Die Technik ist so alt wie das frei im Raume bewegliche Leben überhaupt. Nur die Pflanze ist, so wie wir die Natur sehen, der bloße Schauplatz technischer Vorgänge. Das Tier hat, da es sich bewegt, auch eine Technik der Bewegung, um sich zu erhalten und sich zu wehren.
Die ursprüngliche Beziehung zwischen einem wachen Mikrokosmos und seinem Makrokosmos – der » Natur« – besteht in einem Abtasten durch die Sinne, [Vgl. Bd. II, S. 561.] das sich vom bloßen Eindruck der Sinne zum Urteil der Sinne erhebt und damit schon kritisch (»scheidend«) oder, was dasselbe ist, kausal zerlegend wirkt. Das Festgestellte [Vgl. Bd. II, S. 565.] wird zu einem möglichst vollständigen System ursprünglichster Erfahrungen – »Kennzeichen« – ergänzt,Vgl. Bd. II, S. 583. eine unwillkürliche Methode, durch die man sich in seiner Welt zu Hause fühlt, die bei vielen Tieren zu einer erstaunlichen Fülle von Erfahrungen geführt hat und über die kein menschliches Naturwissen hinausführt. Aber ursprüngliches Wachsein ist immer tätiges Wachsein, fernab von aller bloßen »Theorie«, und so ist es die kleine Technik des Alltags, an welcher diese Erfahrungen ohne Absicht erworben werden, und zwar an Dingen, insofern sie tot sind. [Vgl. Bd. II, S. 582. ]Das ist der Unterschied von Kultus und Mythos,Vgl. Bd. II, S. 884. denn auf dieser Stufe gibt es keine Grenze zwischen Religion und Profanem. Alles Wachsein ist Religion.
Die entscheidende Wendung in der Geschichte des höheren Lebens erfolgt, wenn das Fest-stellen der Natur – um sich danach zu richten – in ein Fest-machen übergeht, durch das sie absichtlich verändert wird. Damit wird die Technik gewissermaßen souverän, und die triebhafte Urerfahrung geht in ein Urwissen über, dessen man sich deutlich »bewußt« ist. Das Denken hat sich vom Empfinden emanzipiert. Erst die Wortsprache hat diese Epoche heraufgeführt. Durch die Ablösung der Sprache vom SprechenVgl. Bd. II, S. 717. ist für die Mitteilungssprachen ein Schatz von Zeichen entstanden, die mehr sind als Kennzeichen, nämlich mit einem Bedeutungsgefühl verbundene Namen, mit denen der Mensch das Geheimnis der Numina, seien es Gottheiten oder Naturkräfte, in seiner Gewalt hat, und Zahlen (Formeln, Gesetze einfachster Art), durch welche die innere Form des Wirklichen vom Zufällig-Sinnlichen abgezogen wird.Vgl. Bd. II, S. 883 f.
Damit entsteht aus dem System von Kennzeichen eine Theorie, ein Bild, das sich auf den Höhen zivilisierter Technik ebenso wie in ihren primitiven Anfängen aus der Technik des Tages ablöst, als ein Stück untätigen Wachseins, nicht umgekehrt sie hervorgebracht hat. [Vgl. Bd. II, S. 886f.] Man »weiß«, was man will, aber es muß vieles geschehen sein, um das Wissen zu haben, und man täusche sich nicht über den Charakter dieses »Wissens«. Durch die zahlenmäßige Erfahrung kann der Mensch mit dem Geheimnis schalten, aber er hat es nicht enthüllt. Das Bild des modernen Zauberers: eine Schalttafel mit ihren Hebeln und Bezeichnungen, an welcher der Arbeiter durch einen Fingerdruck gewaltige Wirkungen ins Dasein ruft, ohne von ihrem Wesen eine Ahnung zu haben, ist das Symbol der menschlichen Technik überhaupt. Das Bild der Lichtwelt um uns, so wie wir es kritisch, zerlegend, als Theorie, als Bild entwickelt haben, ist nichts als eine solche Tafel, auf der gewisse Dinge so bezeichnet sind, daß auf eine Berührung hin gewisse Wirkungen mit Sicherheit erfolgen. Das Geheimnis bleibt nicht weniger drückend.Die »Richtigkeit« physikalischer Kenntnisse, d. h. ihre bis zum Augenblick durch keine Erscheinung widerlegte Anwendbarkeit als » Deutung«, ist ganz unabhängig von ihrem technischen Werte.
Eine sicherlich falsche und in sich widerspruchsvolle Theorie kann für die Praxis wertvoller sein als eine »richtige« und tiefe, und die Physik hütet sich längst, die Worte falsch und richtig im populären Sinne überhaupt auf ihre Bilder statt auf die bloßen Formeln anzuwenden. Aber durch diese Technik greift das Wachsein doch gewaltsam in die Tatsachenwelt; das Leben bedient sich des Denkens wie eines Zauberschlüssels, und auf der Höhe mancher Zivilisation, in deren großen Städten, erscheint endlich der Augenblick, wo technische Kritik es müde ist, dem Leben zu dienen, und sich zu seinem Tyrannen aufwirft. Eine Orgie dieses entfesselten Denkens von wahrhaft tragischen Maßen erlebt die abendländische Kultur eben jetzt.
Man hat den Gang der Natur belauscht und sich Zeichen gemerkt. Man beginnt sie nachzuahmen durch Mittel und Methoden, welche die Gesetze kosmischen Taktes sich zunutze machen. Der Mensch wagt es, die Gottheit zu spielen und man begreift, daß die frühesten Verfertiger und Kenner dieser künstlichen Dinge – denn hier ist Kunst als Gegenbegriff von Natur entstanden –, vor allem die Hüter der Schmiedekunst von den andern als etwas ganz Seltsames betrachtet, scheu verehrt oder verabscheut wurden. Es gab einen immer wachsenden Schatz solcher Erfindungen, die oft gemacht, wieder vergessen, nachgeahmt, gemieden, verbessert wurden und die endlich doch für ganze Erdteile einen Bestand von selbstverständlichen Mitteln ergaben, Feuer, Metallbehandlung, Werkzeuge, Waffen, Pflug und Boot, Hausbau, Tierzucht und Getreidesaat. Vor allem sind es die Metalle, an deren Ort ein unheimlich mystischer Zug den primitiven Menschen lockt. Uralte Handelsbahnen ziehen sich nach geheim gehaltenen Erzlagern durch das Leben des besiedelten Landes und über durchruderte Meere hin, auf denen dann später Kulte und Ornamente wandern; sagenhafte Namen wie Zinninseln und Goldland haften in der Phantasie. Der Urhandel ist Metallhandel: so dringt in die erzeugende und verarbeitende Wirtschaft eine dritte, fremde und abenteuerliche, frei durch die Länder schweifende ein.
Auf dieser Grundlage erhebt sich nun die Technik der hohen Kulturen, in deren Rang, Farbe und Leidenschaft sich die ganze Seele dieser großen Wesen ausspricht. Es versteht sich fast von selbst, daß der antike Mensch, euklidisch wie er sich in seiner Umwelt fühlt, schon dem Gedanken der Technik feindselig gegenübersteht. Meint man mit antiker Technik etwas, das sich mit entschiedenem Streben über die allverbreiteten Fertigkeiten der mykenischen Zeit erhebt, so gibt es keine antike Technik. [Was Diels, »Antike Technik«, zusammengetragen hat, ist ein umfangreiches Nichts. Zieht man ab, was noch der babylonischen Zivilisation angehört wie die Sonnen- und Wasseruhren, oder schon der arabischen Frühzeit wie die Chemie und die Wunderuhr von Gaza, oder was in jeder andren Kultur durch seine bloße Anführung beleidigen würde wie die Arten der Türverschlüsse, so bleibt kein Rest.] Diese Trieren sind vergrößerte Ruderboote, die Katapulte und Onager ersetzen Arme und Fäuste und können sich mit den assyrischen und chinesischen Kriegsmaschinen nicht messen, und was Heron und andere seines Schlages betrifft, so sind Einfälle keine Erfindungen. Es fehlt das innere Gewicht, das Schicksalvolle des Augenblicks, die tiefe Notwendigkeit. Man spielt hier und da mit Kenntnissen – warum auch nicht –, die wohl aus dem Osten stammten, aber niemand achtet darauf, und niemand denkt vor allem daran, sie ernstlich in die Lebensgestaltung einzuführen.
Etwas ganz anderes ist die faustische Technik, die mit dem vollen Pathos der dritten Dimension, und zwar von den frühesten Tagen der Gotik an auf die Natur eindringt, um sie zu beherrschen. Hier und nur hier ist die Verbindung von Einsicht und Verwertung selbstverständlich.Die chinesische Kultur hat fast alle abendländischen Erfindungen auch gemacht – darunter Kompaß, Fernrohr, Buchdruck, Schießpulver, Papier, Porzellan –, aber der Chinese schmeichelt der Natur etwas ab, er vergewaltigt sie nicht. Er empfindet wohl den Vorteil seines Wissens und macht Gebrauch davon, aber er stürzt sich nicht darauf, um es auszubeuten. Die Theorie ist von Anfang an Arbeitshypothese. [Vgl. Bd. II, S. 929.] Der antike Grübler »schaut« wie die Gottheit des Aristoteles, der arabische sucht als Alchimist nach dem Zaubermittel, dem Stein der Weisen, mit dem man die Schätze der Natur mühelos in seinen Besitz bringt, der abendländische will die Welt nach seinem Willen lenken. [Es ist derselbe Geist, der den Geschäftsbegriff der Juden, Parsen, Armenier, Griechen, Araber von dem der abendländischen Völker unterscheidet.]
Der faustische Erfinder und Entdecker ist etwas Einziges. Die Urgewalt seines Wollens, die Leuchtkraft seiner Visionen, die stählerne Energie seines praktischen Nachdenkens müssen jedem, der aus fremden Kulturen herüberblickt, unheimlich und unverständlich sein, aber sie liegen uns allen im Blute. Unsre ganze Kultur hat eine Entdeckerseele. Ent-decken, das was man nicht sieht, in die Lichtwelt des inneren Auges ziehen, um sich seiner zu bemächtigen, das war vom ersten Tage an ihre hartnäckigste Leidenschaft. Alle ihre großen Erfindungen sind in der Tiefe langsam gereift, durch vorwegnehmende Geister verkündigt und versucht worden, um mit der Notwendigkeit eines Schicksals endlich hervorzubrechen. Sie waren alle schon dem seligen Grübeln frühgotischer Mönche ganz nahegerückt.Vgl. Bd. II, S. 928. Albertus Magnus lebte in der Sage als der große Zauberer fort. Roger Bacon hat über Dampfmaschine, Dampfschiff und Flugzeug nachgedacht. (F. Strunz, Die Gesch. der Naturwiss. im Mittelalter (1910), S. 88). Wenn irgendwo, so offenbart sich hier der religiöse Ursprung alles technischen Denkens.Vgl. Bd. II, S. 884. Diese inbrünstigen Erfinder in ihren Klosterzellen, die unter Beten und Fasten Gott sein Geheimnis abrangen, empfanden das als einen Gottesdienst. Hier ist die Gestalt Fausts entstanden, das große Sinnbild einer echten Erfinderkultur. Die scientia experimentalis, wie zuerst Roger Bacon die Naturforschung definiert hatte, die gewaltsame Befragung der Natur mit Hebeln und Schrauben beginnt, was als Ergebnis in den mit Fabrikschloten und Fördertürmen übersäten Ebenen der Gegenwart vor unsern Augen liegt. Aber für sie alle bestand auch die eigentlich faustische Gefahr, daß der Teufel seine Hand im Spiele hatte,Vgl. Bd. II, S. 912f. um sie im Geist auf jenen Berg zu führen, wo er ihnen alle Macht der Erde versprach. Das bedeutet der Traum jener seltsamen Dominikaner wie Petrus Peregrinus vom perpetuum mobile, mit dem Gott seine Allmacht entrissen gewesen wäre. Sie erlagen diesem Ehrgeiz immer wieder; sie zwangen der Gottheit ihr Geheimnis ab, um selber Gott zu sein. Sie belauschten die Gesetze des kosmischen Taktes, um sie zu vergewaltigen, und sie schufen so die Idee der Maschine als eines kleinen Kosmos, der nur noch dem Willen des Menschen gehorcht. Aber damit überschritten sie jene feine Grenze, wo für die anbetende Frömmigkeit der andern die Sünde begann, und daran gingen sie zugrunde, von Bacon bis Giordano Bruno. Die Maschine ist des Teufels: so hat der echte Glaube immer wieder empfunden.
Eine Leidenschaft im Erfinden zeigt schon die gotische Architektur – die man mit der gewollten Formenarmut der dorischen vergleiche – und unsre gesamte Musik. Es erscheinen der Buchdruck und die Fernwaffe..Das griechische Feuer will nur erschrecken und zünden; hier aber wird die Spannkraft der Explosionsgase in Bewegungsenergie umgesetzt. Wer das ernsthaft vergleicht, der versteht den Geist abendländischer Technik nicht. Auf Kolumbus und Kopernikus folgen das Fernrohr, das Mikroskop, die chemischen Elemente und endlich die ungeheure Summe der technischen Verfahren des frühen Barock.
Dann aber folgt zugleich mit dem Rationalismus die Erfindung der Dampfmaschine, die alles umstürzt und das Wirtschaftsbild von Grund aus verwandelt. Bis dahin hatte die Natur Dienste geleistet, jetzt wird sie als Sklavin ins Joch gespannt und ihre Arbeit wie zum Hohn nach Pferdestärken bemessen. Man ging von der Muskelkraft des Negers, die in organisierten Betrieben angesetzt wurde, zu den organischen Reserven der Erdrinde über, wo die Lebenskraft von Jahrtausenden als Kohle aufgespeichert liegt, und richtet heute den Blick auf die anorganische Natur, deren Wasserkräfte schon zur Unterstützung der Kohle herangezogen sind. Mit den Millionen und Milliarden Pferdekräften steigt die Bevölkerungszahl in einem Grade, wie keine andre Kultur es je für möglich gehalten hätte. Dieses Wachstum ist ein Produkt der Maschine, die bedient und gelenkt sein will und dafür die Kräfte jedes Einzelnen verhundertfacht. Um der Maschine willen wird das Menschenleben kostbar. Arbeit wird das große Wort des ethischen Nachdenkens. Es verliert im 18. Jahrhundert in allen Sprachen seine geringschätzige Bedeutung. Die Maschine arbeitet und zwingt den Menschen zur Mitarbeit. Die ganze Kultur ist in einen Grad von Tätigkeit geraten, unter dem die Erde bebt.
Was sich nun im Laufe kaum eines Jahrhunderts entfaltet, ist ein Schauspiel von solcher Größe, daß den Menschen einer künftigen Kultur mit andrer Seele und andern Leidenschaften das Gefühl überkommen muß, als sei damals die Natur ins Wanken geraten. Auch sonst ist die Politik über Städte und Völker hinweggeschritten; menschliche Wirtschaft hat tief in die Schicksale der Tier- und Pflanzenwelt eingegriffen, aber das rührt nur an das Leben und verwischt sich wieder. Diese Technik aber wird die Spur ihrer Tage hinterlassen, wenn alles andere verschollen und versunken ist. Diese faustische Leidenschaft hat das Bild der Erdoberfläche verändert.
Es ist das hinaus- und hinaufdrängende und eben deshalb der Gotik tief verwandte Lebensgefühl, wie es in der Kindheit der Dampfmaschine durch die Monologe des Goetheschen Faust zum Ausdruck gelangte. Die trunkene Seele will Raum und Zeit überfliegen. Eine unnennbare Sehnsucht lockt in grenzenlose Fernen. Man möchte sich von der Erde lösen, im Unendlichen aufgehen, die Bande des Körpers verlassen und im Weltraum unter Sternen kreisen. Was am Anfang die glühend hinaufschwebende Inbrunst des heiligen Bernhard suchte, was Grünewald und Rembrandt in ihren Hintergründen und Beethoven in den erdfernen Klängen seiner letzten Quartette ersannen, das kehrt nun wieder in dem durchgeistigten Rausch dieser dichten Folge von Erfindungen. Deshalb entsteht dieser phantastische Verkehr, der Erdteile in wenigen Tagen kreuzt, der mit schwimmenden Städten über Ozeane setzt, Gebirge durchbohrt, in unterirdischen Labyrinthen rast, von der alten, in ihren Möglichkeiten längst erschöpften Dampfmaschine zur Gaskraftmaschine übergeht und von Straßen und Schienen sich endlich zum Flug in die Lüfte erhebt; deshalb wird das gesprochene Wort in einem Augenblick über alle Meere gesandt; deshalb bricht dieser Ehrgeiz der Rekorde und Dimensionen hervor, die Riesenhallen für Riesenmaschinen, ungeheure Schiffe und Brückenspannungen, wahnwitzige Bauten bis in die Wolken hinauf, fabelhafte Kräfte, die auf einen Punkt zusammengedrängt sind und dort der Hand eines Kindes gehorchen, stampfende, zitternde, dröhnende Werke aus Stahl und Glas, in denen sich der winzige Mensch als unumschränkter Herr bewegt und endlich die Natur unter sich fühlt.
Und diese Maschinen werden in ihrer Gestalt immer mehr entmenschlicht, immer asketischer, mystischer, esoterischer. Sie umspinnen die Erde mit einem unendlichen Gewebe feiner Kräfte, Ströme und Spannungen. Ihr Körper wird immer geistiger, immer verschwiegener. Diese Räder, Walzen und Hebel reden nicht mehr. Alles, was entscheidend ist, zieht sich ins Innere zurück. Man hat die Maschine als teuflisch empfunden, und mit Recht. Sie bedeutet in den Augen eines Gläubigen die Absetzung Gottes. Sie liefert die heilige Kausalität dem Menschen aus und sie wird schweigend, unwiderstehlich, mit einer Art von vorausschauender Allwissenheit von ihm in Bewegung gesetzt.
7
Niemals hat sich ein Mikrokosmos dem Makrokosmos überlegener gefühlt. Hier gibt es kleine Lebewesen, die durch ihre geistige Kraft das Unlebendige von sich abhängig gemacht haben. Nichts scheint diesem Triumph zu gleichen, der nur einer Kultur geglückt ist und vielleicht nur für eine kleine Zahl von Jahrhunderten.
Aber gerade damit ist der faustische Mensch zum Sklaven seiner Schöpfung geworden. Seine Zahl und die Anlage seiner Lebenshaltung werden durch die Maschine auf eine Bahn gedrängt, auf der es keinen Stillstand und keinen Schritt rückwärts gibt. Der Bauer, der Handwerker, selbst der Kaufmann erscheinen plötzlich unwesentlich gegenüber den drei Gestalten, welche sich die Maschine auf dem Weg ihrer Entwicklung herangezüchtet hat: dem Unternehmer, dem Ingenieur, dem Fabrikarbeiter. Aus einem ganz kleinen Zweige des Handwerks, der verarbeitenden Wirtschaft, ist in dieser einen Kultur und keiner andern der mächtige Baum aufgewachsen, welcher über alle sonstigen Berufe seinen Schatten wirft: die Wirtschaftswelt der Maschinenindustrie. [Marx hat ganz recht: es ist eine, und zwar die stolzeste Schöpfung des Bürgertums, aber er, der ganz im Banne des Schemas Altertum – Mittelalter – Neuzeit denkt, hat nicht bemerkt, daß es nur das Bürgertum einer einzigen Kultur ist, von dem das Schicksal der Maschine abhängt. Solange es die Erde beherrscht, versucht jeder Nichteuropäer das Geheimnis dieser furchtbaren Waffe zu ergründen, aber innerlich lehnt er sie trotzdem ab, der Japaner und Inder wie der Russe und Araber. Es ist tief im Wesen der magischen Seele begründet, daß der Jude als Unternehmer und Ingenieur der eigentlichen Schöpfung von Maschinen aus dem Wege geht und sich auf die geschäftliche Seite ihrer Herstellung legt. Aber ebenso blickt der Russe mit Furcht und Haß auf diese Tyrannei der Räder, Drähte und Schienen, und wenn er sich heute und morgen auch der Notwendigkeit fügt, so wird er einst das alles aus seiner Erinnerung und seiner Umgebung streichen und eine ganz andere Welt um sich errichten, in der es nichts von dieser teuflischen Technik mehr gibt.]
Sie zwingt den Unternehmer wie den Fabrikarbeiter zum Gehorsam. Beide sind Sklaven, nicht Herren der Maschine, die ihre teuflische geheime Macht erst jetzt entfaltet. Aber wenn die sozialistische Theorie der Gegenwart nur die Leistung des letzten hat sehen wollen und für sie allein das Wort Arbeit in Anspruch nahm, so ist diese doch nur durch die souveräne und entscheidende Leistung des ersten möglich. Das berühmte Wort von dem starken Arm, der alle Räder stillstehen läßt, ist falsch gedacht. Anhalten – ja, aber dazu braucht man nicht Arbeiter zu sein. In Bewegung halten – nein. Der Organisator und Verwalter bildet den Mittelpunkt in diesem künstlichen und komplizierten Reich der Maschine. Der Gedanke hält es zusammen, nicht die Hand. Aber gerade deshalb ist eine Gestalt noch wichtiger, um diesen stets gefährdeten Bau zu erhalten, als die ganze Energie unternehmender Herrenmenschen, die Städte aus dem Boden wachsen lassen und das Bild der Landschaft verändern, eine Gestalt, die man im politischen Streit zu vergessen pflegt: der Ingenieur, der wissende Priester der Maschine. Nicht nur die Höhe, das Dasein der Industrie hängt vom Dasein von hunderttausend begabten, streng geschulten Köpfen ab, welche die Technik beherrschen und immer weiter entwickeln. Der Ingenieur ist in aller Stille ihr eigentlicher Herr und ihr Schicksal. Sein Denken ist als Möglichkeit, was die Maschine als Wirklichkeit ist. Man hat, ganz materialistisch, die Erschöpfung der Kohlenlager gefürchtet. Aber solange es technische Pfadfinder von Rang gibt, gibt es keine Gefahren dieser Art. Erst wenn der Nachwuchs dieser Armee ausbleibt, deren Gedankenarbeit mit der Arbeit der Maschine eine innere Einheit bildet, muß die Industrie trotz Unternehmertum und Arbeiterschaft erlöschen. Gesetzt den Fall, daß das Heil der Seele den Begabtesten künftiger Generationen näher liegt als alle Macht in dieser Welt, daß unter dem Eindruck der Metaphysik und Mystik, die heute den Rationalismus ablösen, das wachsende Gefühl für den Satanismus der Maschine gerade die Auslese des Geistes ergreift, auf die es ankommt – es ist der Schritt von Roger Bacon zu Bernhard von Clairvaux –, so wird nichts das Ende dieses großen Schauspiels aufhalten, das ein Spiel der Geister ist, bei dem die Hände nur helfen dürfen.
Die abendländische Industrie hat die alten Handelsbahnen der übrigen Kulturen verlagert. Die Ströme des Wirtschaftslebens bewegen sich nach den Sitzen der »Königin Kohle« und den großen Rohstoffgebieten hin; die Natur wird erschöpft, der Erdball dem faustischen Denken in Energien geopfert. Die arbeitende Erde ist der faustische Aspekt; in ihrem Anblick stirbt der Faust des zweiten Teils, in dem die unternehmende Arbeit ihre höchste Verklärung erfahren hat. Nichts ist dem ruhend gesättigten Sein der antiken Kaiserzeit mehr entgegengesetzt. Der Ingenieur ist es, der dem römischen Rechtsdenken am fernsten steht, und er wird es durchsetzen, daß seine Wirtschaft ihr eignes Recht erhält, in dem Kräfte und Leistungen die Stelle von Person und Sache einnehmen.
8
Aber ebenso titanisch ist nun der Ansturm des Geldes auf diese geistige Macht. Auch die Industrie ist noch erdverbunden wie das Bauerntum. Sie hat ihren Standort und ihre dem Boden entströmenden Quellen der Stoffe. Nur die Hochfinanz ist ganz frei, ganz ungreifbar. Die Banken und damit die Börsen haben sich seit 1789 am Kreditbedürfnis der ins Ungeheure wachsenden Industrie zur eigenen Macht entwickelt und sie wollen, wie das Geld in allen Zivilisationen, die einzige Macht sein. Das uralte Ringen zwischen erzeugender und erobernder Wirtschaft erhebt sich zu einem schweigenden Riesenkampf der Geister, der auf dem Boden der Weltstädte ausgefochten wird. Es ist der Verzweiflungskampf des technischen Denkens um seine Freiheit gegenüber dem Denken in Geld.Dies gewaltige Ringen einer sehr kleinen Zahl stahlharter Rassemenschen von ungeheurem Verstand, wovon der einfache Städter weder etwas sieht noch versteht, läßt von fern betrachtet, welthistorisch also, den bloßen Interessenkampf zwischen Unternehmertum und Arbeitersozialismus zur flachen Bedeutungslosigkeit herabsinken. Die Arbeiterbewegung ist, was ihre Führer aus ihr machen, und der Haß gegen die Inhaber der industriellen Führerarbeit hat sie längst in den Dienst der Börse gestellt. Der praktische Kommunismus mit seinem »Klassenkampf«, einer heute längst veralteten und unecht gewordenen Phrase, ist nichts als ein zuverlässiger Diener des Großkapitals, das ihn wohl zu benützen weiß.
Die Diktatur des Geldes schreitet vor und nähert sich einem natürlichen Höhepunkt, in der faustischen wie in jeder andern Zivilisation. Und nun geschieht etwas, das nur begreifen kann, wer in das Wesen des Geldes eingedrungen ist. Wäre es etwas Greifbares, so wäre sein Dasein ewig; da es eine Form des Denkens ist, so erlischt es, sobald es die Wirtschaftswelt zu Ende gedacht hat, und zwar aus Mangel an Stoff. Es drang in das Leben des bäuerlichen Landes ein und setzte den Boden in Bewegung; es hat jede Art von Handwerk geschäftlich umgedacht; es dringt heute siegreich auf die Industrie ein, um die erzeugende Arbeit von Unternehmern, Ingenieuren und Ausführenden gleichmäßig zu seiner Beute zu machen. Die Maschine mit ihrer menschlichen Gefolgschaft, die eigentliche Herrin des Jahrhunderts, ist in Gefahr, einer stärkeren Macht zu verfallen. Aber damit steht das Geld am Ende seiner Erfolge, und der letzte Kampf beginnt, in welchem die Zivilisation ihre abschließende Form erhält: der zwischen Geld und Blut.
Die Heraufkunft des Cäsarismus bricht die Diktatur des Geldes und ihrer politischen Waffe, der Demokratie. Nach einem langen Triumph der weltstädtischen Wirtschaft und ihrer Interessen über die politische Gestaltungskraft erweist sich die politische Seite des Lebens doch als stärker. Das Schwert siegt über das Geld, der Herrenwille unterwirft sich wieder den Willen zur Beute. Nennt man jene Mächte des Geldes Kapitalismus, [Zu dem die Interessenpolitik der Arbeiterparteien auch gehört, denn sie wollen die Geldwerte nicht überwinden, sondern besitzen.] und Sozialismus den Willen, über alle Klasseninteressen hinaus eine mächtige politisch-wirtschaftliche Ordnung ins Leben zu rufen, ein System der vornehmen Sorge und Pflicht, die das Ganze für den Entscheidungskampf der Geschichte in fester Form hält, so ist das zugleich ein Ringen zwischen Geld und Recht. [Vgl. Bd. II, S. 983.]
Die privaten Mächte der Wirtschaft wollen freie Bahn für ihre Eroberung großer Vermögen. Keine Gesetzgebung soll ihnen im Wege stehen. Sie wollen die Gesetze machen, in ihrem Interesse, und sie bedienen sich dazu ihres selbstgeschaffenen Werkzeugs, der Demokratie, der bezahlten Partei. Das Recht bedarf, um diesen Ansturm abzuwehren, einer vornehmen Tradition, des Ehrgeizes starker Geschlechter, der nicht im Anhäufen von Reichtümern sondern in den Aufgaben echten Herrschertums jenseits aller Geldvorteile Befriedigung findet.
Eine Macht läßt sich nur durch eine andere stürzen, nicht durch ein Prinzip, und es gibt dem Geld gegenüber keine andere. Das Geld wird nur vom Blut überwältigt und aufgehoben. Das Leben ist das erste und letzte, das kosmische Dahinströmen in mikrokosmischer Form. Es ist die Tatsache innerhalb der Welt als Geschichte. Vor dem unwiderstehlichen Takt der Geschlechterfolgen schwindet zuletzt alles hin, was das Wachsein in seinen Geisteswelten aufgebaut hat. Es handelt sich in der Geschichte um das Leben und immer nur um das Leben, die Rasse, den Triumph des Willens zur Macht, und nicht um den Sieg von Wahrheiten, Erfindungen oder Geld. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht: sie hat immer dem stärkeren, volleren, seiner selbst gewisseren Leben Recht gegeben, Recht nämlich auf das Dasein, gleichviel ob es vor dem Wachsein recht war, und sie hat immer die Wahrheit und Gerechtigkeit der Macht, der Rasse geopfert und die Menschen und Völker zum Tode verurteilt, denen die Wahrheit wichtiger war als Taten, und Gerechtigkeit wesentlicher als Macht. So schließt das Schauspiel einer hohen Kultur, diese ganze wundervolle Welt von Gottheiten, Künsten, Gedanken, Schlachten, Städten, wieder mit den Urtatsachen des ewigen Blutes, das mit den ewig kreisenden kosmischen Fluten ein und dasselbe ist. Das helle, gestaltenreiche Wachsein taucht wieder in den schweigenden Dienst des Daseins hinab, wie es die chinesische und römische Kaiserzeit lehren; die Zeit siegt über den Raum, und die Zeit ist es, deren unerbittlicher Gang den flüchtigen Zufall Kultur auf diesem Planeten in den Zufall Mensch einbettet, eine Form, in welcher der Zufall Leben eine Zeitlang dahinströmt, während in der Lichtwelt unserer Augen sich dahinter die strömenden Horizonte der Erdgeschichte und Sternengeschichte auftun.
Für uns aber, die ein Schicksal in diese Kultur und diesen Augenblick ihres Werdens gestellt hat, in welchem das Geld seine letzten Siege feiert und sein Erbe, der Cäsarismus, leise und unaufhaltsam naht, ist damit in einem eng umschriebenen Kreise die Richtung des Wollens und Müssens gegeben, ohne das es sich nicht zu leben lohnt. Wir haben nicht die Freiheit, dies oder jenes zu erreichen, aber die, das Notwendige zu tun oder nichts. Und eine Aufgabe, welche die Notwendigkeit der Geschichte gestellt hat, wird gelöst, mit dem einzelnen oder gegen ihn.
Ducunt fata volentem, nolentem trahunt. [„Den Willigen führt das Schicksal, den Unwilligen zerrt es mit sich.“ – Seneca, Epistulae morales 107,11]
Erster Band, drittes Kapitel:
MAKROKOSMOS
II. Apollinische, faustische, magische Seele (Abschnitte 6 - 15)
(Hervorhebungen von ethos.at) / Sätze in […] sind im Buch Fußnoten von O.S.
Abschnitt 11 (zitiert nach Projekt Gutenberg)
So stammt die Erscheinung des großen Stils also aus dem Wesen des Makrokosmos, aus dem Ursymbol einer großen Kultur. Man wird, wenn man den Gehalt des Wortes zu würdigen weiß, das nicht einen Formbestand, sondern eine Formgeschichte bezeichnet, die fragmentarischen und chaotischen Kunstäußerungen des Urmenschentums nicht zu der umfassenden Bestimmtheit eines solchen Stils mit seiner Entwicklung über Jahrhunderte hin in Beziehung bringen. Erst die als Einheit nach Ausdruck und Bedeutung wirkende Kunst der großen Kulturen – und nun nicht mehr die Kunst allein – hat Stil.
Zur organischen Geschichte eines Stils gehört ein Vorher, Außerhalb und Nachher. Die »Stiertafel« aus der 1. ägyptischen Dynastie ist noch nicht »ägyptisch«. [H. Schäfer, Von ägyptischer Kunst I, S. 15 f.] Erst mit der 3. Dynastie erhalten die Werke, und zwar plötzlich und sehr bestimmt einen Stil. Ebenso steht die Karolingerkunst »zwischen den Stilen«. Man bemerkt ein Tasten, ein Ausprobieren verschiedener Formen, aber nichts von innerlich notwendigem Ausdruck. Der Schöpfer des Aachener Münsters »denkt sicher, baut sicher, aber er fühlt nicht sicher«. [Frankl, Baukunst des Mittelalters (1918), S. 16 ff.] Die Marienkirche auf der Feste Würzburg (um 700) hat ihr Seitenstück in Saloniki (St. Georg); die Kirche von Germigny des Près (um 800) ist mit Kuppeln und Hufeisenbögen fast eine Moschee. 850-950 besteht für das ganze Abendland eine Lücke. Ebenso steht die russische Kunst noch heute »zwischen den Stilen«. Auf den primitiven, von Norwegen bis zur Mandschurei verbreiteten Holzbau mit steilem, achteckigem Zeltdach dringen über die Donau byzantinische, über den Kaukasus armenisch-persische Motive ein.
Eine Wahlverwandtschaft zwischen der russischen und magischen Seele ist wohl zu fühlen, aber das Ursymbol des Russentums, die unendliche Ebene, [Vgl. Bd. II, S. 921 Anm. Der Mangel jeder Vertikaltendenz im russ. Lebensgefühl erscheint auch in der Sagengestalt des Jlja von Murom (Bd. II, S. 788). Der Russe hat nicht das geringste Verhältnis zu einem Vatergott. Sein Ethos ist nicht Sohnes-, sondern reine Bruderliebe, die allseitig in die Menschenebene ausstrahlt. Auch Christus wird als Bruder empfunden. Das faustische, ganz vertikale Streben nach persönlicher Vervollkommnung ist dem echten Russen eitel und unverständlich. Auch die russischen Ideen von Staat und Eigentum entbehren jeder Vertikaltendenz.] findet wie religiös, so auch architektonisch noch keinen sicheren Ausdruck. Das Kirchendach hebt sich hügelartig kaum von der Landschaft ab, und auf ihm sitzen die Zeltdachspitzen mit den »Kokoschniks«, welche das Aufstreben verschleiern und aufheben sollen. Sie steigen nicht auf wie gotische Türme und decken nicht zu wie die Kuppeln der Moschee, sondern sie »sitzen« und betonen damit das Horizontale des Baus, der lediglich von außen aufgefaßt sein will. Als der Synod um 1670 die Zeltdächer verbot und die orthodoxen Zwiebelkuppeln vorschrieb, wurden die schweren Kuppeln auf schlanke Zylinder aufgesetzt, die in beliebiger ZahlAuf der Friedhofskirche in Kishi sind es 22. auf der Dachebene »sitzen«. [J. Grabar, Gesch. der russ. Kunst (1911, russ.) I-III. A. Eliasberg, Russ. Baukunst (1922), Einleitung.] Das ist noch kein Stil, aber das Versprechen eines Stils, der erst mit der eigentlich russischen Religion erwachen wird.
Das Erwachen erfolgte im faustischen Abendlande kurz vor 1000. Mit einem Schlage ist der romanische Stil fertig. An Stelle der verschwimmenden Raumgliederung mit unsicherem Grundriß tritt plötzlich eine straffe Dynamik des Raumes. Von Anfang an sind Außen- und Innenbau in ein festes Verhältnis gesetzt, so daß die Wand von der Formensprache durchdrungen wird wie in keiner andern Kultur; von Anfang an ist die Bedeutung der Fenster und der Türme bestimmt. Die Idee der Form war unwiderruflich gegeben, nur die Entwicklung stand noch bevor.
Mit einem schöpferischen Akt von gleicher Unbewußtheit und symbolischer Wucht beginnt der ägyptische Stil. Das Ursymbol des Weges ist plötzlich ins Leben getreten, mit dem Beginn der 4. Dynastie (2550 v. Chr.). Das weltbildende Tiefenerlebnis dieser Seele empfängt seinen Gehalt vom Richtungsfaktor selbst: die Tiefe des Raumes als erstarrte Zeit, die Ferne, der Tod, das Schicksal selbst beherrschen den Ausdruck; die bloß sinnlichen Dimensionen der Länge und Breite werden zur begleitenden Fläche, die den Weg des Schicksals einengt und vorschreibt. Das ägyptische Flachrelief, auf Nahsicht berechnet und in seiner reihenweisen Anordnung den Betrachter zwingend, in vorgeschriebener Richtung die Wandflächen abzuschreiten, taucht ebenso plötzlich gegen Beginn der 5. Dynastie auf.
[Die Klarheit in der Anlage der ägyptischen und abendländischen Geschichte gestattet einen bis ins einzelne gehenden Vergleich, der wohl einer kunsthistorischen Untersuchung wert wäre. Die 4. Dynastie des strengen Pyramidenstils (2550-2450, Cheops, Chephren) entspricht der Romanik (980-1100); die 5. Dynastie (2450-2320, Sahu-rê) der Frühgotik (1100-1230); die 6. Dynastie, die Blütezeit der archaischen Bildniskunst (2320-2190, Phiops I. u. II.) der Hochgotik (1230-1400). (Siehe die Bemerkung auf Tafel I nach S. 70. H. K.)]
Die noch späteren Reihen von Sphinxen und Statuen, die Felsen- und Terrassentempel verstärken beständig die Tendenz auf die einzige Ferne, welche die Welt des ägyptischen Menschen kennt, das Grab, den Tod. Man bemerke wohl, wie schon die Säulenreihen der Frühzeit nach Durchmesser und Abstand der mächtigen Schäfte genau so gegliedert sind, daß sie jeden seitlichen Durchblick verdecken. Das hat sich in keiner andern Architektur wiederholt.
Die Größe dieses Stils erscheint uns starr und unveränderlich. Er steht allerdings jenseits der Leidenschaft, die noch sucht und fürchtet und untergeordneten Einzelzügen damit eine rastlose persönliche Bewegtheit im Lauf der Jahrhunderte erteilt; aber sicherlich wäre dem Ägypter der faustische Stil – er bildet von der frühesten Romanik bis zum Rokoko und Empire ebenfalls eine Einheit – in seiner Unruhe und seinem ständigen Suchen nach einem Etwas viel gleichförmiger erschienen, als wir uns vorstellen können. Vergessen wir nicht, daß aus dem hier vorausgesetzten Begriff des Stils folgt, daß Romanik, Gotik, Renaissance, Barock, Rokoko nur Stufen ein und desselben Stils sind, an dem wir selbst naturgemäß vor allem das Wechselnde, das Auge anders gearteter Menschen das Bleibende bemerken. In der Tat beweisen zahllose Umbauten romanischer Werke im Barock-, spätgotischer im Rokokostil, die durch nichts auffallen, die innere Einheit der nordischen Renaissance und ebenso die der Bauernkunst, in welcher Gotik und Barock völlig identisch geworden ist, die Straßen alter Städte, deren Giebel und Fassaden aller Stilarten einen reinen Einklang bilden, und die Unmöglichkeit, Romanik und Gotik, Renaissance und Barock, Barock und Rokoko in einzelnen Fällen überhaupt zu unterscheiden, daß die »Familienähnlichkeit« dieser Abschnitte viel größer ist, als sie den Angehörigen erscheint.
Der ägyptische Stil ist rein architektonisch bis zum Erlöschen dieser Seele. Er ist der einzige, in welchem neben der Architektur ein verzierendes Ornament vollkommen fehlt. Er gestattet keine Abschweifung zu unterhaltenden Künsten, keine Tafelmalerei, keine Büste, keine weltliche Musik. In der Antike geht mit der Ionik der Schwerpunkt der Stilbildung von der Architektur zu einer von ihr unabhängigen Plastik über; im Barock geht er hinüber zur Musik, deren Formensprache ihrerseits die gesamte Baukunst des 18. Jahrhunderts beherrscht; im Arabertum löst seit Justinian und dem Perserkönig Chosru Nuschirwan die Arabeske alle Formen der Architektur, Malerei und Plastik zu Stileindrücken auf, die wir heute als kunstgewerblich bezeichnen könnten. In Ägypten bleibt die Herrschaft der Architektur unangefochten. Sie mildert lediglich ihre Sprache. In den Hallen der Pyramidentempel der 4. Dynastie (Pyramide des Chephren) stehen schmucklose, scharfkantige Pfeiler. In den Bauten der 5. Dynastie (Pyramide des Sahu-rê) erscheint die Pflanzensäule. Steingewordene Lotus- und Papyrusbündel wachsen riesenhaft aus dem Fußboden von durchscheinendem Alabaster auf, der das Wasser bedeutet, eingeschlossen von purpurnen Wänden. Die Decke ist mit Vögeln und Sternen geschmückt. Der heilige Weg vom Torbau zur Grabkammer, das Bild des Lebens, ist ein Strom. Es ist der Nil selbst, der mit dem Ursymbol der Richtung eins wird. Der Geist der mütterlichen Landschaft vereinigt sich mit der aus ihm entsprungenen Seele. In China tritt an die Stelle der mächtigen Pylonenwand, die mit der engen Pforte dem Nahenden entgegendroht, die »Geistermauer« (yin-pi), die den Eingang verdeckt. Der Chinese schlüpft in das Leben, wie er von da an das Tao des Lebenspfades verfolgt; und wie das Niltal zu den Hügelebenen der Landschaft am Hoangho, so verhält sich der steinumschlossene Tempelweg zu den verschlungenen Pfaden der chinesischen Gartenarchitektur. Ganz ebenso knüpft sich das euklidische Dasein der antiken Kultur in geheimnisvoller Weise an die vielen kleinen Inseln und Vorgebirge des Ägäischen Meeres, und die stets im Unendlichen schweifende Leidenschaft des Abendlandes an die weiten fränkischen, burgundischen, sächsischen Ebenen.
12
Der ägyptische Stil ist der Ausdruck einer tapferen Seele. Seine Strenge und Wucht ist vom ägyptischen Menschen selbst nie empfunden und betont worden. Man wagte alles, aber man schwieg darüber. In der Gotik und im Barock dagegen wird die Überwindung des Schweren zum stets bewußten Motiv der Formensprache. Das Drama Shakespeares redet laut von den verzweifelten Kämpfen zwischen Wille und Welt. Der antike Mensch war den »Mächten« gegenüber schwach. Die Katharsis von Furcht und Mitleid, das Aufatmen der apollinischen Seele im Augenblick der Peripetie war nach Aristoteles die beabsichtigte Wirkung der attischen Tragödie. Indem der Grieche das Schauspiel vor sich hatte, wie jemand, den er kannte – denn jeder kannte den Mythos und seinen Helden und lebte in ihm – vom Geschick sinnlos zertreten wurde, ohne daß ein Widerstand gegen die Mächte denkbar war, und in prachtvoller Haltung, trotzend, heroisch unterging, erfolgte in seiner euklidischen Seele eine wunderbare Erhebung. War das Leben nichts wert, so war es doch die große Geste, mit der man es verlor. Man wollte und wagte nichts, aber man fand eine berauschende Schönheit im Ertragen. Schon die Gestalt des Dulders Odysseus, in viel höherem Grade noch das Urbild des hellenischen Menschen, Achilles, zeugt davon. Die Moral der Cyniker, der Stoa, Epikurs, das allgemeine hellenische Ideal der Sophrosyne und Ataraxia, Diogenes in seinem Fasse, der δεωρια huldigend – das alles ist verkappte Feigheit vor allem Schweren und Verantwortungsvollen und sehr verschieden von dem Stolz der ägyptischen Seele; der apollinische Mensch geht dem Leben im Grund aus dem Wege, bis zum Selbstmord, der in dieser Kultur allein – wenn man wiederum von verwandten indischen Idealen absieht – den Rang einer hohen sittlichen Handlung erhielt und mit der Feierlichkeit eines sakralen Symbols behandelt wurde; der dionysische Rausch erscheint der gewaltsamen Übertäubung von etwas verdächtig, das die ägyptische Seele gar nicht kannte. Und deshalb ist diese Kultur die des Kleinen, Leichten, Einfachen. Ihre Technik ist, an der ägyptischen und babylonischen gemessen, ein geistvolles Nichts (Vgl. Bd. II, S. 1186 Anm. 1). Ihr Ornament ist so arm an Erfindung wie kein zweites. Der Typenschatz ihrer Plastik in Stand und Haltung läßt sich an den Fingern abzählen.
»Bei der auffallenden Formenarmut des dorischen Stils, auch wenn sie zu Anfang der Entwicklung geringer gewesen sein sollte als späterhin, drehte sich alles um die Proportionen und um die Maße.« [Koldewey-Puchstein, Die griech. Tempel in Unteritalien und Sizilien I, S. 228.] Aber auch da welches Geschick im Vermeiden! Die griechische Architektur mit ihrem Gleichmaß von Stütze und Last und den ihr eigentümlichen kleinen Maßstäben wirkt wie eine ständige Ausflucht vor schwierigen tektonischen Problemen, die man am Nil und später im hohen Norden mit einer Art von dunklem Pflichtgefühl geradezu suchte und die man in der mykenischen Zeit gekannt und sicherlich nicht vermieden hat. Der Ägypter liebte das harte Gestein ungeheurer Bauten; es entsprach seinem Selbstbewußtsein, nur das Schwerste als Aufgabe zu wählen; der Grieche mied es. Erst suchte seine Baukunst kleine Aufgaben, dann hörte sie ganz auf. Vergleicht man sie in ihrem vollen Umfange mit der Gesamtheit der ägyptischen, mexikanischen oder gar abendländischen, so ist man über die Geringfügigkeit der Stilentwicklung erstaunt. Mit einigen Variationen des dorischen Tempeltyps ist sie erschöpft und mit der Erfindung des korinthischen Kapitäls (um 400) bereits abgeschlossen. Alles Spätere ist Abwandlung von Vorhandenem.
Das hat zu einer fast körperhaften Befestigung der Formtypen und Stilgattungen geführt. Man konnte zwischen ihnen wählen, aber ihre strengen Grenzen überschreiten durfte man nicht. Das wäre gewissermaßen die Anerkennung eines unendlichen Raumes von Möglichkeiten gewesen. Es gab drei Säulenordnungen und eine bestimmte Gliederung des Architravs für jede. Da bei dem Wechsel von Triglyphen und Metopen der schon von Vitruv behandelte Konflikt an den Ecken entstand, so wurden die letzten Interkolumnien schmaler gehalten, denn niemand dachte daran, hier neue Formen zu ersinnen. Wollte man größere Abmessungen, so wurde die Zahl der Elemente über, neben, hinter einander vermehrt. Das Kolosseum besitzt drei Ringe, das Didymaion in Milet drei Säulenreihen in der Front, der Gigantenfries von Pergamon eine endlose Folge unverbundener Einzelmotive. Ebenso steht es mit den Stilgattungen der Prosa und den Typen der Lyrik, Erzählung und Tragödie. Überall ist der Aufwand im Entwerfen der Grundform auf ein Minimum beschränkt und die Gestaltungskraft des Künstlers auf die Feinheit im einzelnen verwiesen: eine reine Statik der Gattungen, die im schärfsten Widerspruch zur faustischen Dynamik der Geburt immer neuer Typen und Formgebiete steht.
13
Der Organismus großer Stilfolgen wird nun übersehbar geworden sein. Der erste, dem dieser Blick aufging, war wiederum Goethe. In seinem »Winckelmann« sagt er von Vellejus Paterculus: »Auf seinem Standorte war es ihm nicht gegeben, die ganze Kunst als ein Lebendiges ζωον anzusehen, das einen unmerklichen Ursprung, ein langsames Wachstum, einen glänzenden Augenblick seiner Vollendung, eine stufenfällige Abnahme, wie jedes andere organische Wesen, nur in mehreren Individuen notwendig darstellen muß.« In diesem Satz ist die ganze Morphologie der Kunstgeschichte enthalten. Stile folgen nicht aufeinander wie Wellen und Pulsschläge. Mit der Persönlichkeit einzelner Künstler, ihrem Willen und Bewußtsein haben sie nichts zu schaffen. Im Gegenteil, der Stil ist es, welcher den Typus des Künstlers schafft. Der Stil ist wie die Kultur ein Urphänomen im strengsten Sinne Goethes, sei es der Stil von Künsten, Religionen, Gedanken oder der Stil des Lebens selbst. So gut »Natur« ein immer neues Erlebnis des wachen Menschen ist, als sein alter ego und Spiegelbild in der Umwelt, so der Stil. Deshalb kann es im historischen Gesamtbilde einer Kultur nur einen, den Stil dieser Kultur, geben. Es war falsch, bloße Stilphasen wie Romanik, Gotik, Barock, Rokoko, Empire als eigene Stile zu unterscheiden und mit Einheiten von ganz anderem Range wie dem ägyptischen, chinesischen Stil oder gar einem »prähistorischen Stil« gleichzusetzen.
Gotik und Barock: das ist Jugend und Alter desselben Inbegriffs von Formen, der reifende und der gereifte Stil des Abendlandes. Es fehlt unserer Kunstforschung in diesem Punkte an Distanz, an der Unbefangenheit des Blickes und dem guten Willen zur Abstraktion. Man hat es sich bequem gemacht und alle stark empfundenen Formgebiete unterschiedslos als »Stile« aufgereiht. Daß auch hier das Schema Altertum-Mittelalter-Neuzeit den Blick verwirrte, braucht kaum erwähnt zu werden. In der Tat steht selbst ein Meisterwerk der strengsten Renaissance wie der Hof des Palazzo Farnese der Vorhalle von St. Patroklus in Soest, dem Innern des Magdeburger Doms und den Treppenhäusern süddeutscher Schlösser des 18. Jahrhunderts unendlich viel näher als dem Tempel von Pästum oder dem Erechtheion. Dasselbe Verhältnis besteht zwischen Dorik und Ionik. Deshalb kann die ionische Säule mit dorischen Bauformen eine ebenso vollkommene Verbindung eingehen wie Spätgotik und frühes Barock in St. Lorenz zu Nürnberg oder späte Romanik mit spätem Barock in dem schönen Oberteil des Mainzer Westchores. Deshalb hat unser Auge noch kaum gelernt, im ägyptischen Stil die der dorisch-gotischen Jugend und dem ionisch-barocken Alter entsprechenden Elemente des Alten und des Mittleren Reiches zu unterscheiden, die seit der 12. Dynastie sich in der Formensprache aller größeren Werke mit vollkommener Harmonie durchdringen.
Der Kunstgeschichte steht die Aufgabe bevor, die vergleichenden Biographien der großen Stile zu schreiben. Sie haben alle, als Organismen derselben Gattung, eine Lebensgeschichte von verwandter Struktur.
Am Anfang steht der verzagte, demütige, reine Ausdruck einer eben erwachenden Seele, die noch nach einem Verhältnis zur Welt sucht, der sie, obwohl einer eigenen Schöpfung, doch fremd und befremdet gegenübersteht. Es liegt Kinderangst in den Bauten des Bischofs Bernward von Hildesheim, in der altchristlichen Katakombenmalerei und den Pfeilersälen zu Anfang der 4. Dynastie. Ein Vorfrühling der Kunst, ein tiefes Ahnen künftiger Gestaltenfülle, eine mächtige, verhaltene Spannung ruht über der Landschaft, die sich, noch ganz bäuerlich, mit den ersten Burgen und kleinen Städten schmückt. Dann folgt der jauchzende Aufschwung in der hohen Gotik, der konstantinischen Zeit mit ihren Säulenbasiliken und Kuppelkirchen, und den reliefgeschmückten Tempeln der 5. Dynastie. Man begreift das Sein; der Glanz einer heiligen, vollkommen gemeisterten Formensprache breitet sich aus und der Stil reift zu einer majestätischen Symbolik der Tiefenrichtung und des Schicksals heran. Aber der jugendliche Rausch geht zu Ende. Aus der Seele selbst erhebt sich Widerspruch. Renaissance, dionysisch-musikalische Feindschaft gegen die apollinische Dorik, der auf Alexandria blickende Stil im Byzanz von 450 gegenüber der heiter-lässigen antiochenischen Kunst bedeuten einen Augenblick der Auflehnung und der versuchten oder erreichten Zerstörung des Erworbenen, deren sehr schwierige Erörterung hier nicht am Platze ist. Damit tritt das Mannesalter der Stilgeschichte in Erscheinung. Die Kultur wird zum Geist der großen Städte, die jetzt die Landschaft beherrschen; sie durchgeistigt auch den Stil. Die erhabene Symbolik verblaßt; das Ungestüm übermenschlicher Formen geht zu Ende; mildere weltlichere Künste verdrängen die große Kunst des gewachsenen Steins; selbst in Ägypten wagen Plastik und Fresko sich etwas leichter zu bewegen. Der Künstler erscheint. Er »entwirft« jetzt, was bis dahin aus dem Boden wuchs. Noch einmal steht das Dasein, das sich selbst bewußt gewordne, vom Ländlich-Traumhaften und Mystischen gelöst, fragwürdig da und ringt nach einem Ausdruck seiner neuen Bestimmung: zu Beginn des Barock, wo Michelangelo in wildem Unbefriedigtsein und sich gegen die Schranken seiner Kunst bäumend die Peterskuppel auftürmt, zur Zeit Justinians I., wo seit 520 die Hagia Sophia und die mosaikgeschmückten Kuppelbasiliken von Ravenna entstehen, im Ägypten zu Beginn der 12. Dynastie, deren Blüte für die Griechen der Name Sesostris zusammenfaßte, und um 600 in Hellas, wo viel später noch Aischylos verrät, was eine hellenische Architektur in dieser entscheidenden Epoche hätte ausdrücken können und müssen.
Dann erscheinen die leuchtenden Herbsttage des Stils: noch einmal malt sich in ihm das Glück der Seele, die sich ihrer letzten Vollkommenheit bewußt wird. Die Rückkehr »zur Natur«, damals schon als nahe Notwendigkeit von Denkern und Dichtern, von Rousseau, Gorgias und den »Gleichzeitigen« der andern Kulturen gefühlt und angekündigt, verrät sich in der Formenwelt der Künste als empfindsame Sehnsucht und Ahnung des Endes. Hellste Geistigkeit, heitre Urbanität und Wehmut eines Abschiednehmens: von diesen letzten farbigen Jahrzehnten der Kultur hat Talleyrand später gesagt: » Qui n'a pas vécu avant 1789, ne connait pas la douceur de vivre.« [Jeder, der nicht vor 1789 gelebt hat, kennt die Süße des Lebens nicht.]
So erscheint die freie, sonnige, raffinierte Kunst zur Zeit Sesostris' III. (um 1850). Dieselben kurzen Augenblicke gesättigten Glücks tauchen auf, als unter Perikles die bunte Pracht der Akropolis und die Werke des Phidias und Zeuxis entstanden. Wir finden sie ein Jahrtausend später zur Ommaijadenzeit in der heitern Märchenwelt maurischer Bauten mit ihren fragilen Säulen- und Hufeisenbögen, die sich im Leuchten der Arabesken und Stalaktiten in die Luft auflösen möchten, und wieder ein Jahrtausend darauf in der Musik Haydns und Mozarts, den Schäfergruppen von Meißner Porzellan, den Bildern Watteaus und Guardis und den Werken deutscher Baumeister in Dresden, Potsdam, Würzburg und Wien.
Dann erlischt der Stil. Auf die bis zum äußersten Grade durchgeistigte, zerbrechliche, der Selbstvernichtung nahe Formensprache des Erechtheion und des Dresdner Zwingers folgt ein matter und greisenhafter Klassizismus, in hellenistischen Großstädten ebenso wie im Byzanz von 900 und im Empire des Nordens. Ein Hindämmern in leeren, ererbten, in archaistischer oder eklektischer Weise vorübergehend wieder belebten Formen ist das Ende. Halber Ernst und fragwürdige Echtheit beherrschen das Künstlertum. In diesem Falle befinden wir uns heute. Es ist ein langes Spielen mit toten Formen, an denen man sich die Illusion einer lebendigen Kunst erhalten möchte.
14
Erst wenn man sich von der Täuschung jener antiken Kruste befreit hat, die mit einer archaisierenden oder willkürlich eigne und fremde Motive mischenden Fortsetzung innerlich längst erstorbener Kunstübungen den jungen Osten in der Kaiserzeit überlagert; wenn man in der altchristlichen Kunst und in allem, was in der »spätrömischen« wirklich lebendig ist, die Frühzeit des arabischen Stils erkannt hat; wenn man in der Epoche Justinians I. das genaue Seitenstück des spanisch-venezianischen Barock wiederfindet, wie es unter den großen Habsburgern Karl V. und Philipp II. Europa beherrschte; in den Palästen von Byzanz mit ihren mächtigen Schlachtenbildern und Prunkszenen, deren längst untergegangene Pracht höfische Literaten wie Prokop von Cäsarea in schwülstigen Reden und Versen feiern, das Seitenstück der Paläste des frühen Barock in Madrid, Venedig und Rom und die dekorativen Riesengemälde von Rubens und Tintoretto: erst dann gewinnt das bisher als Einheit nicht begriffene Phänomen der arabischen Kunst – das volle erste Jahrtausend unserer Zeitrechnung umfassend – Gestalt. Da es an entscheidender Stelle im Bilde der Gesamtkunstgeschichte steht, so hat das bisher waltende Mißverstehen die Erkenntnis der organischen Zusammenhänge überhaupt verhindert. [Zum folg. Bd. II, Kap. III.]
Merkwürdig und für den, der hier einen Blick für bisher unbekannte Dinge gewonnen hat, ergreifend ist es zu sehen, wie diese junge Seele, vom Geist der antiken Zivilisation in Fesseln gehalten, unter den Eindrücken vor allem der politischen Allmacht Roms es nicht wagte, sich frei zu regen, wie sie demütig sich veralteten und fremden Formen unterwarf und sich mit griechischer Sprache, griechischen Ideen und Kunstmotiven zu bescheiden suchte. Die inbrünstige Hingabe an die Mächte der jungen Tageswelt, wie sie die Jugend jeder Kultur bezeichnet, die Demut des gotischen Menschen in seinen frommen, hochgewölbten Räumen mit den Pfeilerstatuen und lichterfüllten Glasgemälden, die hohe Spannung der ägyptischen Seele inmitten ihrer Welt der Pyramiden, Lotossäulen und Reliefsälen mischt sich hier mit einem geistigen Niederknien vor erstorbenen Formen, die man für ewig hielt. Daß ihre Herübernahme und Weiterbildung trotzdem nicht gelang, daß wider Willen und unvermerkt, ohne den Stolz der Gotik auf das Eigne, das man hier, im Syrien der Kaiserzeit, fast beklagte und als Verfall empfand, eine geschlossene neue Formenwelt emporstieg und mit ihrem Geiste – unter der Maske griechisch-römischer Baugewohnheiten – selbst Rom erfüllte, wo syrische Meister am Pantheon und den Kaiserforen arbeiteten, das beweist wie kein zweites Beispiel die Urkraft eines jungen Seelentums, das seine Welt erst noch zu erobern hat.
Wie jede Frühzeit, so sucht auch diese den Ausdruck ihres Seelentums in eine neue Ornamentik, vor allem in deren Gipfel, eine religiöse Architektur zu legen. Aber von dieser ganzen reichen Formenwelt ist bis vor kurzem nur die des westlichen Randes beachtet und deshalb als Heimat und Sitz der magischen Stilgeschichte aufgefaßt worden, obwohl – wie in Religion, Wissenschaft, sozialem und politischem Leben – nur Ausstrahlungen über die Ostgrenze des römischen Imperiums nach Westen drangen.
[Vgl. Bd. II, S. 798f. Riegl Stilfragen: Grundlagen zu einer Geschichte der Ornamentik (1893). Spätrömische Kunstindustrie (1901). und Strzygowski Amida (1910).Die bildende Kunst des Ostens (1916). Altai-Iran (1917). Die Baukunst der Armenier und Europa (1918).]
Riegl und Strzygowski haben diese Lage erkannt, aber um darüber hinaus zu einem vollständigen Bilde der arabischen Kunstentwicklung zu gelangen, muß man sich gleichmäßig von philologischen und religiösen Vorurteilen befreien. Es ist ein Unglück, daß die Kunstforschung religiöse Grenzen wenn auch nicht mehr anerkennt, so doch unbewußt zugrunde legt. Denn es gibt weder eine spätantike noch eine altchristliche noch eine islamische Kunst in dem Sinne, daß die Gemeinschaft der Bekenner in ihrer Mitte einen eignen Stil ausgebildet hätte. Vielmehr besitzt die Gesamtheit dieser Religionen von Armenien bis nach Südarabien und Axum und von Persien bis Byzanz und Alexandria hin trotz aller Gegensätze im einzelnenSie sind nicht größer als die zwischen dorischer, attischer und etruskischer Kunst und wohl geringer als die, welche um 1450 zwischen florentinischer Renaissance, nordfranzösischer, spanischer und ostdeutscher (Backstein-)Gotik bestanden. einen künstlerischen Ausdruck von großer Einheitlichkeit. Alle diese Religionen, die christliche, jüdische, persische, manichäische, synkretistische [Vgl. Bd. II, S. 862ff.] besaßen Kultbauten und, zum wenigsten in der Schrift, ein Ornament vom höchsten Range; und mochten ihre Lehren im einzelnen noch so verschieden sein, so geht doch eine gleichartige Religiosität durch alle hindurch und fand in einem gleichartigen Tiefenerlebnis mit daraus folgender Raumsymbolik ihren Ausdruck. Es gibt etwas in den Basiliken der Christen, hellenistischen Juden und Baalskulte, in den Mithräen, mazdaischen Feuertempeln und Moscheen, was von einem gleichen Seelentum spricht: das Höhlengefühl.
Die Forschung muß entschieden den Versuch machen, die bis jetzt vollkommen vernachlässigte Architektur der südarabischen und persischen Tempel, der syrischen wie der mesopotamischen Synagogen, der Kultbauten im östlichen Kleinasien und selbst in AbessinienDie ältesten christlichen Anlagen im Reich von Axum stimmen sicherlich mit den heidnischen der Sabäer überein. festzustellen, und von den christlichen Kirchen nicht nur die des paulinischen Westens zu begreifen, sondern auch die des nestorianischen Ostens vom Euphrat bis nach China, wo man sie vielsagend in alten Berichten als »persische Tempel« bezeichnet hat. Wenn von all diesen Bauten sich bis jetzt so gut wie nichts dem Blick aufgedrängt hat, so kann der Grund sehr wohl auch darin liegen, daß mit dem Vordringen erst des Christentums und dann des Islams die Kultstätten die Religion gewechselt haben, ohne daß Anlage und Stil dem widersprechen. Von spätantiken Tempeln wissen wir das, aber wie viele Kirchen Armeniens mögen einst Feuertempel gewesen sein?
Der künstlerische Mittelpunkt dieser Kultur liegt entschieden, wie Strzygowski richtig erkannt hat, in dem Städtedreieck Edessa-Nisibis-Amida. Von hier aus herrscht nach Westen die »spätantike« Pseudomorphose: [Vgl. Bd. II, S. 784.] das paulinische, auf den Konzilen von Ephesus und Chalcedon [Vgl. Bd. II, S. 874, 923.] siegreiche, in Byzanz und Rom geltende Christentum, das westliche Judentum und die Kulte des Synkretismus. Der Bautypus der Pseudomorphose ist die Basilika, auch für Juden und Heiden. [Kohl und Watzinger, Antike Synagogen in Galiläa (1916).] Basiliken sind die Baalheiligtümer in Palmyra, Baalbek und zahlreichen andern Orten, zum Teil älter als das Christentum und vielfach später in dessen Gebrauch übergegangen. Sie drückt mit den Mitteln der Antike deren Gegensatz aus, ohne sich von den Mitteln befreien zu können: das ist das Wesen und die Tragik der Pseudomorphose. Je mehr im »antiken« Synkretismus der euklidische Ort, an welchem ein Kult zu Hause ist, in die örtliche unbestimmte Gemeinde übergeht, welche sich zu dem Kult bekennt, [Vgl. Bd. II, S. 801.] desto wichtiger wird das Tempelinnere gegenüber der Außenseite, ohne daß Grundriß, Säulenordnung und Dach sich viel zu ändern brauchen.
Das Raumgefühl wird anders, nicht – zunächst – die Ausdrucksmittel. Im heidnischen Kultbau der Kaiserzeit führt ein deutlicher, aber heute noch unbeachteter Weg von den ganz körperhaften Tempeln augusteischen Stils, deren Cella architektonisch nichts bedeutet, zu solchen, deren Inneres allein Bedeutung besitzt. Zuletzt ist das Außenbild des dorischen Peripteros auf die vier Innenwände übertragen. Die Säulenreihe vor der fensterlosen Wand verleugnet den dahinter liegenden Raum, aber dort für den Betrachter draußen, hier für die Gemeinde im Innern. Es ist demgegenüber von geringerer Bedeutung, ob der ganze Raum zugedeckt ist, wie in der eigentlichen Basilika, oder nur das Allerheiligste wie im Sonnentempel von Baalbek mit dem gewaltigen Vorhof,Frauberger, Die Akropolis von Baalbek, Tf. 22. der später stets zur Anlage der Moschee gehört und vielleicht südarabischer Herkunft ist. [Diez, Die Kunst der islamischen Völker, S. 8 f. In altsabäischen Tempeln liegt vor der Orakelkapelle (makanat) der Altarhof (mahdar).] Für die Bedeutung des Mittelschiffs als ursprünglichem Hallenhof spricht nicht nur die besondere Entwicklung des basilikalen Typus in der ostsyrischen Steppe, vor allem im Hauran, sondern auch die Anordnung in Vorhalle, Schiff und Altarraum, wobei zu diesem als dem eigentlichen Tempel Stufen hinaufführen und die Seitenschiffe als ursprüngliche Hallen eines Hofes blind endigen, so daß die Apsis allein dem Mittelschiff entspricht. In S. Paolo zu Rom ist dieser Ursinn der Anlage sehr deutlich; aber trotzdem hat die Pseudomorphose – die Umkehrung des antiken Tempels – die Ausdrucksmittel bestimmt: Säule und Architrav. Wie ein Symbol wirkt der christliche Umbau des Tempels von Aphrodisias in Karien, bei welchem innerhalb der Säulenstellung die Cella beseitigt und dafür außerhalb eine neue Wand errichtet wurde. [Wulff, Altchristl. und byz. Kunst, S. 227.]
Jenseits des Bereichs der Pseudomorphose aber konnte das Höhlengefühl seine Formensprache frei entfalten, und hier wurde deshalb der Deckenabschluß betont, während man dort aus Protest gegen das antike Fühlen das bloße »Innen« hervorhob. Wann und wo die verschiedenen Möglichkeiten der Wölbung, Kuppel, Gurttonnen, Kreuzgewölbe, technisch entstanden sind, ist, wie schon gesagt wurde, ohne Bedeutung. Entscheidend bleibt, daß um Christi Geburt mit dem Aufschwung des neuen Weltgefühls die neue Raumsymbolik begonnen haben muß, sich dieser Formen zu bedienen und sie auf den Ausdruck hin weiter zu entwickeln. Es läßt sich vielleicht noch nachweisen, daß die Feuertempel und Synagogen Mesopotamiens Kuppelbauten gewesen sind, vielleicht auch die Tempel des Attar in Südarabien. [Auf dessen Reichtum an Tempeln Plinius hinweist. Von einem südarabischen Tempeltypus stammt wahrscheinlich auch die Basilika als Querhaus – mit dem Eingang an der Langseite –, wie sie im Hauran vorkommt und im quergeteilten Altarraum von S. Paolo in Rom deutlich ausgeprägt ist.]
Sicher war es der heidnische Marniontempel in Gaza; und lange bevor unter Konstantin das Christentum paulinischer Richtung sich dieser Formen bemächtigte, sind sie von Baumeistern morgenländischer Herkunft in alle Teile des Imperiums getragen worden, wo sie für den weltstädtischen Geschmack einen ungewohnten Reiz bedeuteten. Unter Trajan hat sie Apollodor aus Damaskus für die Wölbung des Venus- und Romatempels verwendet. Die Kuppelräume der Caracallathermen und die unter Gallienus entstandene Minerva medica sind von Syrern gebaut. Das Meisterwerk aber, die früheste aller Moscheen, ist der Neubau des Pantheon durch Hadrian, der hier sicherlich, wie es seinem Geschmack entsprach, Kultbauten nachahmen wollte, die er im Orient gesehen hatte. [Mit den etruskischen Rundbauten (Altmann, Die ital. Rundbauten, 1906) hat dieses Stück reiner Innenarchitektur weder technisch noch dem Raumgefühl nach irgend etwas zu tun. Dagegen entspricht es den Kuppeln in Hadrians tiburtinischer Villa.]
Der Zentralkuppelbau, in welchem das magische Weltgefühl am reinsten zum Ausdruck gelangt, hat sich jenseits der römischen Grenze entwickelt. Für die Nestorianer wurde er die einzige Form, die sie von Armenien bis nach China hin verbreitet haben, in Gemeinschaft mit Manichäern und Mazdaisten. Aber mit dem Verfall der Pseudomorphose und dem Verschwinden der letzten synkretistischen Kulte dringt sie siegreich auch auf die Basilika des Westens ein. In Südfrankreich, wo es noch zur Zeit der Kreuzzüge manichäische Sekten gab, wurde die Form des Ostens heimisch. Unter Justinian vollzog sich in Byzanz und Ravenna die Durchdringung beider zur Kuppelbasilika. Die reine Basilika wurde in das germanische Abendland verdrängt, wo sie später durch die Energie des faustischen Tiefendranges zum Dom umgestaltet worden ist; die Kuppelbasilika breitete sich von Byzanz und Armenien nach Rußland aus, wo sie langsam wieder als Außenbau empfunden wurde, dessen Dachgestaltung der Schwerpunkt des Symbolischen ist. In der arabischen Welt aber führte der Islam als Erbe des monophysitischen und nestorianischen Christentums und der Juden wie der Perser die Entwicklung zu Ende. Als er die Hagia Sophia in eine Moschee verwandelte, nahm er ein altes Eigentum wieder in Besitz. Der islamische Kuppelbau ist dem mazdaischen und nestorianischen auf den gleichen Bahnen nach Schantung und Indien gefolgt; im fernen Westen entstanden Moscheen in Spanien und Sizilien und zwar, wie es scheint, eher von ostaramäisch-persischem als von westaramäisch-syrischem Stil.
[Vielleicht sind Synagogen als Kuppelbauten lange vor dem Islam dorthin und nach Marokko gelangt, und zwar durch das Mission treibende mesopotamische Judentum (Bd. II, S. 811), das dem persischen Geschmack näherstand, während das Judentum der Pseudomorphose Basiliken baute und auch in seinen römischen Katakomben dem westlichen Christentum künstlerisch völlig gleichsteht. Von Spanien aus ist der jüdisch-persische Stil für die Synagogen des Abendlandes vorbildlich geworden, eine Entwicklung, die der Kunstforschung bis jetzt noch völlig entgangen ist.]
Und während Venedig auf Byzanz und Ravenna blickte (San Marco), lernten seit der Glanzzeit der normannischen Stauferherrschaft in Palermo die Städte längs der italischen Westküste, auch Florenz, diese maurischen Bauten bewundern und nachahmen. Mehr als ein Motiv, das der Renaissance als antik galt, wie der Hallenhof und die Verbindung von Bogen und Säule, stammt von dort.
Was von der Architektur, gilt in erhöhtem Maße von der Ornamentik, die in der arabischen Welt sehr früh alle Figurenbildnerei überwunden und in sich aufgenommen hat. Als Arabeskenkunst trat sie dann in verführerischem Reiz dem jungen Kunstwollen des Abendlandes entgegen.
Die frühchristlich-spätantike Kunst der Pseudomorphose zeigt dieselbe ornamentale und figürliche Mischung von ererbtem Fremdem und eben geborenem Eignem wie die karolingisch-frühromanische vor allem in Südfrankreich und Oberitalien. Dort mischt sich Hellenistisches mit Frühmagischem, hier Maurisch-Byzantinisches mit Faustischem. Der Forscher muß Linie für Linie, Ornament für Ornament auf das Formgefühl hin untersuchen, um die beiden Schichten voneinander zu trennen. In jedem Architrav, jedem Fries, jedem Kapitäl findet ein heimliches Ringen zwischen den gewollten alten und den ungewollten, aber siegreichen neuen Motiven statt. Überall wirkt das Durchdringen späthellenistischen und früharabischen Formgefühls verwirrend, in den Bildnisbüsten der Stadt Rom, wo oft nur die Haarbehandlung der neuen Ausdrucksweise angehört, in den Akanthusranken oft ein und desselben Frieses, wo die Arbeit des Meißels und des Tiefbohrers nebeneinander stehen, an den Sarkophagen des 3. Jahrhunderts, wo eine kindliche Stimmung in der Art Giottos und Pisanos sich mit einem gewissen späten großstädtischen Naturalismus kreuzt, bei dem man etwa an David oder Carstens denkt, und an Bauten wie der Basilika des Maxentius und manchen noch sehr antik empfundenen Teilen der Thermen und Kaiserfora.
Trotzdem ist das arabische Seelentum um seine Blüte betrogen worden, wie ein junger Baum, den ein gestürzter Urwaldstamm im Wachstum hindert und verkümmern läßt. Hier findet sich keine leuchtende Epoche, die als solche gefühlt und erlebt wurde wie damals, als mit den Kreuzzügen zugleich die Holzdecken der Dome sich zu steinernen Kreuzgewölben schlossen und die Idee des unendlichen Raumes durch ihr Inneres verwirklicht und vollendet wurde. Die politische Schöpfung Diokletians – des ersten Kalifen – wurde durch die Tatsache in ihrer Schönheit gebrochen, daß es die ganze Masse stadtrömischer Verwaltungsgewohnheiten war, die er, auf antikem Boden, als gegeben anerkennen mußte und die sein Werk zu einer bloßen Reform verjährter Zustände herabsetzte. Und doch tritt mit ihm die Idee des arabischen Staates hell ans Licht. Erst aus der diokletianischen Gründung und der etwas älteren und in jeder Hinsicht für diese vorbildlichen des Sassanidenreiches läßt sich das Ideal ahnen, das hier zur Entfaltung hätte kommen sollen. Und so war es überall. Man hat bis zum heutigen Tage als letzte Schöpfungen der Antike bewundert, was sich selbst nicht anders aufgefaßt wissen wollte: Das Denken Plotins und Marc Aurels, die Kulte der Isis, des Mithras, des Sonnengottes, die diophantische Mathematik und endlich die gesamte Kunst, welche von der Ostgrenze des Imperium Romanum herüberstrahlte und in Antiochia und Alexandria nur Stützpunkte fand.
Dies allein erklärt die ungeheure Vehemenz, mit welcher die durch den Islam auch künstlerisch endlich befreite und entfesselte arabische Kultur sich auf alle Länder warf, die ihr seit Jahrhunderten innerlich zugehörten, das Zeichen einer Seele, die fühlt, daß sie keine Zeit zu verlieren hat, die voller Angst die ersten Spuren des Alters bemerkt, bevor sie eine Jugend hatte. Diese Befreiung des magischen Menschentums ist ohnegleichen. Syrien wird 634 erobert, man möchte sagen erlöst; Damaskus fällt 635, Ktesiphon 637. 641 wird Ägypten und Indien erreicht, 647 Karthago, 676 Samarkand, 710 Spanien; 732 stehen die Araber vor Paris. So drängt sich hier in der Hast weniger Jahre die ganze Summe ausgesparter Leidenschaft, verspäteter Schöpfungen, zurückgehaltener Taten zusammen, mit denen andre Kulturen, langsam aufsteigend, die Geschichte von Jahrhunderten füllen konnten. Die Kreuzfahrer vor Jerusalem, die Hohenstaufen in Sizilien, die Hansa in der Ostsee, die Ordensritter im slawischen Osten, die Spanier in Amerika, die Portugiesen in Ostindien, das Reich Karls V., in dem die Sonne nicht unterging, die Anfänge der englischen Kolonialmacht unter Cromwell – das alles sammelt sich in der einen Entladung, welche die Araber nach Spanien, Frankreich, Indien und Turkestan führte.
Es ist wahr: alle Kulturen mit Ausnahme der ägyptischen, mexikanischen und chinesischen haben unter der Vormundschaft älterer Kultureindrücke gestanden; fremde Züge erscheinen in jeder dieser Formenwelten. Die faustische Seele der Gotik, schon durch die arabische Herkunft des Christentums in der Richtung ihrer Ehrfurcht geleitet, griff nach dem reichen Schatz spätarabischer Kunst. Das Arabeskenwerk einer unleugbar südlichen, ich möchte sagen Arabergotik umspinnt die Fassaden der Kathedralen von Burgund und der Provence, beherrscht die äußere Sprache des Straßburger Münsters, mit einer Magie in Stein und führt überall, an Statuen und Portalen in Gewebemustern, Schnitzereien, Metallarbeiten, nicht zum wenigsten in den krausen Figuren des scholastischen Denkens und einem der höchsten abendländischen Symbole, der Sage vom heiligen Gral,Die Gralssage enthält neben altkeltischen starke arabische Züge; aber die Gestalt Parzivals dort, wo Wolfram von Eschenbach über sein Vorbild Chrestien von Troyes hinausgeht, ist rein faustisch. einen stillen Kampf mit dem nordischen Urgefühl einer Wikingergotik, wie sie im Innern des Magdeburger Domes, der Spitze des Freiburger Münsters und der Mystik Meister Eckarts herrscht. Der Spitzbogen droht mehr als einmal seine bindende Linie zu sprengen und in den Hufeisenbogen maurisch-normannischer Bauten überzugehen.
Die apollinische Kunst der dorischen Frühzeit, deren erste Versuche fast verschollen sind, hat ohne Zweifel ägyptische Motive in großer Zahl herübergenommen, um an ihnen und durch sie zu einer eignen Symbolik zu gelangen. Nur die magische Seele der Pseudomorphose wagte es nicht, die Mittel sich anzueignen, ohne sich ihnen hinzugeben, und das macht die Physiognomik des arabischen Stils so unendlich aufschlußreich.
15
So erwächst aus der Idee des Makrokosmos, die im Stilproblem vereinfacht und faßlicher vor Augen tritt, eine Fülle von Aufgaben, deren Lösung noch der Zukunft angehört. Die Formenwelt der Künste für eine Durchdringung des Seelischen ganzer Kulturen nutzbar zu machen, indem man sie durchaus physiognomisch und symbolisch auffaßt, ist ein Unternehmen, dessen bisher gewagte Versuche von unverkennbarer Dürftigkeit sind. Man weiß kaum etwas von einer Psychologie der metaphysischen Grundformen aller großen Architekturen. Man ahnt nicht, welche Aufschlüsse in dem Bedeutungswandel liegen, den eine Gestaltung des reinen Ausgedehnten bei ihrer Übernahme durch eine andere Kultur erfährt. Die Geschichte der Säule ist noch nicht geschrieben worden. Man hat keinen Begriff von der Tiefe einer Symbolik der Kunst mittel, der Kunst werkzeuge.
Da sind die Mosaiken, die in hellenischer Zeit aus Marmorstücken, undurchsichtig, leibhaft-euklidisch gebildet wie die berühmte Alexanderschlacht in Neapel den Fußboden verzierten, die aber mit dem Erwachen der arabischen Seele, nunmehr aus Glasstiften zusammengesetzt und mit einer Unterlage von Goldschmelz, die Wände und Decken der Kuppelbasiliken gleichsam verhüllen. Diese früharabische, von Syrien ausgehende Mosaikmalerei entspricht durchaus der Stufe nach den Glasgemälden gotischer Dome; es sind zwei frühe Künste im Dienste der religiösen Architektur. Die eine weitet den Kirchenraum durch das einströmende Licht zum Weltraum, die andere verwandelt ihn in jene magische Sphäre, deren Goldflimmer aus der irdischen Wirklichkeit zu den Visionen Plotins, des Origenes, der Manichäer, Gnostiker und Kirchenväter und der apokalyptischen Dichtungen entrückt.
Da ist das prachtvolle Motiv der Verbindung des Rundbogens mit der Säule, ebenfalls eine syrische, wenn nicht nordarabische Schöpfung des 3. – »hochgotischen« – Jahrhunderts.Das Verhältnis von Säule und Bogen entspricht seelisch dem von Wandung und Kuppel. Sobald sich zwischen Viereck und Kuppel der Tambour einschiebt, entsteht auch zwischen Kapital und Bogenfuß der Kämpfer. Die umwälzende Bedeutung dieses spezifisch magischen Motivs, das allgemein als antik gilt und für die meisten von uns die Antike geradezu repräsentiert, ist bisher nicht im entferntesten erkannt worden. Der Ägypter hatte seine Pflanzensäulen ohne tiefere Beziehung zur Decke gelassen. Sie stellen das Wachstum dar, nicht die Kraft. Die Antike, für welche die monolithe Säule das stärkste Symbol euklidischen Daseins war, ganz Körper, ganz Einheit und Ruhe, verband sie in strengem Gleichmaß von Vertikale und Horizontale, von Kraft und Last, mit dem Architrav. Hier in Syrien aber – das von der Renaissance mit tragikomischem Irrtum als ausdrücklich antik bevorzugte Motiv, das die Antike gar nicht besaß und nicht besitzen konnte! – wächst unter Verleugnung des körperhaften Prinzips der Last und Trägheit der lichte Bogen aus schlanken Säulen auf; die hier verwirklichte Idee der Lösung von aller Erdenschwere unter gleichzeitiger Bindung des Raumes ist mit der gleichbedeutenden der frei über dem Boden schwebenden und dennoch die Höhle verschließenden Kuppel aufs tiefste verwandt, ein magisches Motiv von stärkster Kraft des Ausdrucks, das seine Vollendung folgerichtig im »Rokoko« maurischer Moscheen und Schlösser fand, wo überirdisch zarte Säulen, oft ohne Basis aus dem Boden wachsend, nur durch einen geheimen Zauber fähig erscheinen, diese ganze Welt zahlloser gekerbter Bögen, leuchtender Ornamente, Stalaktiten und farbensatter Gewölbe zu tragen. Man kann, um die ganze Bedeutung dieser architektonischen Grundform der arabischen Kunst herauszuheben, die Verbindung von Säule und Architrav das apollinische, die von Säule und Rundbogen das magische, die von Pfeiler und Spitzbogen das faustische Leitmotiv nennen.
Nehmen wir ferner die Geschichte des Akanthusmotivs. [A. Riegl, Stilfragen (1893), S. 248 ff., 272 ff.] In der Form, wie es z. B. am Lysikratesdenkmal erscheint, ist es eines der bezeichnendsten der antiken Ornamentik. Es hat Körper. Es bleibt Einzelding. Es ist mit einem Blick in seiner Struktur zu erfassen. Schon in der Kunst der römischen Kaiserfora (des Nerva, des Trajan), am Mars-Ultortempel erscheint es schwerer und reicher. Die organische Gliederung wird so verwickelt, daß sie in der Regel studiert sein will. Die Tendenz, die Fläche zu füllen, tritt hervor. In der byzantinischen Kunst – von deren »latentem sarazenischen Zuge« schon Riegl spricht, ohne den hier aufgedeckten Zusammenhang zu ahnen – wird das Akanthusblatt in ein unendliches Rankenwerk zerlegt, das wie in der Hagia Sophia völlig unorganisch ganze Flächen deckt und überzieht. Zu dem antiken Motiv treten die altaramäischen des Weinlaubs und der Palmette, die schon im jüdischen Ornament eine Rolle spielen. Die Flechtbandmuster »spätrömischer« Mosaikfußböden und Sarkophagkanten, auch geometrische Flächenmuster werden aufgenommen, und endlich entsteht in der ganzen persisch-vorderasiatischen Welt bei steigender Bewegtheit und mit verwirrender Wirkung die Arabeske. Sie ist, antiplastisch bis zum Äußersten, dem Bilde wie dem Körperhaften gleich feindlich, das eigentlich magische Motiv. Selbst unkörperlich, entkörpert sie den Gegenstand, den sie in endloser Fülle überzieht. Ein Meisterwerk dieser Art, ein Stück Architektur, das völlig in Ornamentik aufgegangen ist, stellt die Fassade des von den Ghassaniden erbauten Wüstenschlosses M'schatta dar. Ein über das ganze frühe Abendland verbreitetes und das Karolingerreich völlig beherrschendes Kunstgewerbe byzantinisch-islamitischen Stils – das man bis jetzt lombardisch, fränkisch, keltisch oder altnordisch nannte – wird größtenteils von orientalischen Künstlern gepflegt oder als Vorbild – an Geweben, Metallarbeiten, Waffen – importiert.Dehio, Geschichte der deutschen Kunst I, S. 16 ff. Ravenna, Lucca, Venedig, Granada, Palermo sind die Wirkungszentren dieser damals hochzivilisierten Formensprache, die in Italien noch nach 1000 ausschließlich herrschte, als im Norden die Formen einer neuen Kultur schon fertig und gefestigt waren.
Endlich die veränderte Auffassung des menschlichen Körpers. Sie erfährt mit dem Siege des arabischen Weltgefühls eine völlige Umkehrung. Fast in jedem Römerkopf der vatikanischen Sammlung, der zwischen 100 und 250 entstanden ist, läßt sich der Gegensatz zwischen apollinischem und magischem Gefühl, zwischen der Fundamentierung des Ausdrucks in der Lagerung der Muskelpartien oder im »Blick« feststellen. Man arbeitet – in Rom selbst seit Hadrian – vielfach mit dem Steinbohrer, einem Werkzeug, das dem euklidischen Gefühl dem Stein gegenüber völlig widerspricht. Das Körperhafte, Stoffliche des Marmorblocks wird durch die Arbeit mit dem Meißel, der die Grenzflächen heraushebt, bejaht, durch den Bohrer, der die Flächen bricht und damit Helldunkelwirkungen schafft, verneint. Dementsprechend erlischt, gleichviel ob bei »heidnischen« oder christlichen Künstlern, der Sinn für die Erscheinung des nackten Körpers. Man betrachte die flachen und leeren Antinousstatuen, die doch entschieden antik gemeint waren. Hier ist nur der Kopf physiognomisch bemerkenswert, was in der attischen Plastik nie der Fall ist. Die Gewandung erhält einen ganz neuen Sinn, der die Erscheinung schlechthin beherrscht. Die Konsulstatuen des kapitolinischen MuseumsWulff, Altchristl.-byz. Kunst, S. 153 ff. sind auffallende Beispiele. Durch die gebohrten Pupillen der ins Weite gerichteten Augen wird der gesamte Ausdruck dem Körper entzogen und in jenes »pneumatische«, magische Prinzip gelegt, das der Neuplatonismus und die Beschlüsse der christlichen Konzile nicht weniger als die Mithrasreligion und der Mazdaismus im Menschen voraussetzen. Um 300 schrieb der heidnische »Kirchenvater« Jamblich sein Buch über die Götterstatuen,Vgl. Bd. II, S. 872 f. Geffcken, Der Ausgang des griech.-röm. Heidentums (1920), S. 113. in denen das Göttliche substantiell anwesend ist und auf den Beschauer einwirkt. Gegen diese, der Pseudomorphose angehörende Idee des Bildes hat sich dann von Osten und Süden her der Bildersturm erhoben, der eine Auffassung der künstlerischen Schöpfung voraussetzt, die uns kaum zugänglich ist.
Spengler vs Kant (Kommentar von HTH)
Bruchlinie Raum und Zeit
Die Sonne geht jeden Morgen auf, die Sonne geht jeden Abend unter. Diese Aussage ist falsch, aber menschlich evident und universell, d.h. evident für alle Menschen aller Zeiten aller Kulturen. Alle Menschen bis heute haben die Empfindung, dass die Sonne auf- und untergeht – auch wenn jeder Mensch von heute die astronomische Erklärung dieses Phänomens kennt.
Die Erde dreht sich um die eigene Achse so, dass die Empfindung entsteht, die Sonne würde morgens aufgehen und abends untergehen. Diese Aussage ist korrekt, aber menschlich irrelevant, d.h. irrelevant für das Leben und Zusammenleben der Menschen in ihren Gesellschaften und Kulturen (Familien, Sippen, Völkern, Vereinigungen, Staaten). Nach Sonnenaufgang und -untergang, Tag und Nacht, richten die Menschen bis heute ihr Leben ein – nicht nur die Naturvölker – egal zu welchen Erkenntnisse die Astronomen gelangten und gelangen werden.
Richtig ist der Kausalzusammenhang: Wenn die Sonne aufgeht, wird es hell (Tag), wenn die Sonne untergeht, wird es dunkel (Nacht). Es ist egal, ob man Tag und Nacht gemäß der biblischen Genesis als Göttliche Schöpfung (Vorsehung, Fügung) betrachtet, oder als kausale Folge der Erdumdrehung. Die Drehung des Planeten Erde um die eigene Achse ist ein Phänomen des Weltraums, das wir erkennen und folglich kennen, aber nicht empfinden oder wahrnehmen können, Tag und Nacht sind Namen, die den menschlichen Empfindung entspringen
Tag und Nacht sind die Ur-Einheiten der Zeit. Diese Aussage ist wahr in allen Kulturen aller Zeiten. Die Empfindung der Zeit und die Erfindung der Zeitmessung lassen sich nicht bestreiten. Die Entstehung de Zeitempfindung ist nicht zu trennen von der Tatsache, dass sich die Erde im Raum um die eigene Achse und um die Sonne bewegt. Bewegung und Veränderung sind ohne Zeit nicht denkbar, eine Erde ohne Bewegung ist nicht lebendig und nicht belebbar, die unmittelbare, notwendige Verknüpfung von Zeit und Raum ist somit evident.
Spengler aber, der Naturwissenschaften, Mathematik und Philosophie studierte, bestreitet den evidenten Zusammenhang von Zeit und Raum und sucht sich im 3. Kapitel „MAKROKOSMOS“ den stärksten Gegner, um seine Argumente vorzutragen: Immanuel Kant.
Schon einleitend schreibt Spengler in einer Fußnote: „Es war ein noch heute nicht überwundener Mißgriff Kants von ungeheurer Tragweite, daß er den äußern und innern Menschen zunächst mit den vieldeutigen und vor allem nicht unveränderlichen Begriffen Raum und Zeit ganz schematisch in Verbindung brachte und weiterhin damit in vollkommen falscher Weise Geometrie und Arithmetik verband, an deren Stelle hier der viel tiefere Gegensatz der mathematischen und chronologischen Zahl wenigstens genannt sein soll.“ (28)
Im dritten Kapitel, MAKROKOSMOS, vertieft Spengler dieses Thema in Teil I. Die Symbolik des Weltbildes und das Raumproblem
Teil I des Kapitels beginnt fast poetisch: „Und so erweitert sich der Gedanke einer Weltgeschichte physiognomischer Art [Anm: Physiognomie = Morphologie] zur Idee einer allumfassenden Symbolik. Die Geschichtsforschung in dem hier geforderten Sinne hat nur das Bild des einst Lebendigen und nun Vergangenen zu prüfen und dessen innere Form und Logik festzustellen. Der Schicksalsgedanke ist der letzte, bis zu dem sie vordringen kann. Indessen diese Forschung, so neu und umfassend sie in der hier angegebenen Richtung ist, kann dennoch nur Fragment und Grundlage einer noch umfassenderen Betrachtung sein. Ihr zur Seite steht eine Naturforschung, ebenso fragmentarisch und eingeschränkt in ihrem kausalen Beziehungskreise. Aber weder die tragische noch die technische »Bewegung« – wenn man so sagen darf, um die Untergründe von Erlebtem und Erkanntem zu unterscheiden – erschöpfen das Lebendige selbst. Wir erleben und erkennen, solange wir wach sind, aber wir leben auch, wenn Geist und Sinne schlafen. Mag die Nacht alle Augen schließen, das Blut schläft nicht. Wir sind bewegt im Bewegten – so suchen wir das Unaussprechliche, wovon wir in tiefen Stunden eine innere Gewißheit besitzen, durch ein Grundwort des Naturerkennens anschaulich zu machen; aber für wachende Wesen erscheint das Hier und Dort als unaufhebbares Zweierlei. Jede eigne Regung besitzt Ausdruck, jede fremde macht Eindruck, und so hat alles, dessen wir uns bewußt sind, in welcher Gestalt auch immer, als Seele und Welt, Leben und Wirklichkeit, Geschichte und Natur, Gesetz, Gefühl, Schicksal, Gott, Zukunft und Vergangenheit, Gegenwart und Ewigkeit, für uns noch einen tiefsten Sinn, und das einzige und äußerste Mittel, dieses Unfaßliche faßlich zu machen, liegt in einer Art von Metaphysik, für die alles, es sei, was es wolle, die Bedeutung eines Symbols besitzt. Symbole sind sinnliche Zeichen, letzte, unteilbare und vor allem ungewollte Eindrücke von bestimmter Bedeutung. Ein Symbol ist ein Zug der Wirklichkeit, der für sinnenwache Menschen mit unmittelbarer innerer Gewißheit etwas bezeichnet, das verstandesmäßig nicht mitgeteilt werden kann. […] Es wird hier also nicht davon die Rede sein, was eine Welt »ist«, sondern was sie dem lebendigen Wesen bedeutet, das von ihr umgeben ist.“ (281 f)
Poetische Formulierungen können leicht kippen und zu ominösen Spekulationen führen. Die Fortsetzung jedes poetischen Weges kann leicht auf Abwege führen. Im folgenden Zitat zeichnet sich ab, dass jeder Versuch, „das Unaussprechliche“ wortreich zu benennen und zu beschreiben - widersinnig das Unaussprechliche auszusprechen! - zum Scheitern verurteilt ist.
„Die Wirklichkeit – die Welt in bezug auf eine Seele – ist für jeden einzelnen die Projektion des Gerichteten in den Bereich des Ausgedehnten; sie ist das Eigne, das sich am Fremden spiegelt, sie bedeutet ihn selbst. Durch einen ebenso schöpferischen als unbewußten Akt – nicht »ich« verwirkliche das Mögliche, sondern »es« verwirklicht sich durch mich – wird die Brücke des Symbols geschlagen zwischen dem lebendigen Hier und Dort; es entsteht plötzlich und mit vollkommenster Notwendigkeit aus der Gesamtheit sinnlicher und erinnerter Elemente » die« Welt, die man begreift, für jeden einzelnen » die« einzige. Und deshalb gibt es so viele Welten, als es wache Wesen und im gefühlten Einklang lebende Scharen von Wesen gibt, und im Dasein jedes von ihnen ist die vermeintlich einzige, selbständige und ewige Welt – die jeder mit dem andern gemein zu haben glaubt ein immer neues, einmaliges, nie sich wiederholendes Erlebnis.“ (283)
Damit folgt Spengler der solipsistischen Vorstellung von Johann Gottlieb Fichte – ohne ihn explizit zu erwähnen oder diese verschwommenen Andeutungen zu präzisieren. Der Geist von Fichte schwebt in der Weltanschauung von Spengler immer mit, aber er erwähnt ihn nur fallweise in Nebensetzen.
Analog zu Zeit und Raum unterscheidet Spengler: Richtung und Ausdehnung, das Werdende (Geschehnisse) vom Gewordenen, das Lebende vom Anorganischen, die Geschichte von der Natur. Von der Tatsache, dass sich kein Geschehnis zurückrufen lässt (286), gelangt er zur Tragik des Todes. Der Tod ist gleichzeitig die Tragik des menschlichen Denkvermögens: „Der Mensch ist das einzige Wesen, welches den Tod kennt“ (286). Der Weltseele immanent ist deshalb ist somit die Weltangst. Spengler wird geradezu existenzialistisch wenn er schreibt:
„‘Vom Neugeborenen bis zum fünfjährigen Kinde ist eine schreckliche Entfernung’, hat Tolstoi einmal gesagt. Hier, in diesem entscheidenden Punkt des Daseins, wo der Mensch erst zum Menschen wird und seine ungeheure Einsamkeit im All kennen lernt, enthüllt sich die Weltangst als die rein menschliche Angst vor dem Tode, der Grenze in der Welt des Lichts, dem starren Raum. Hier liegt der Ursprung des höheren Denkens, das zuerst ein Nachdenken über den Tod ist. Jede Religion, jede Naturforschung, jede Philosophie geht von hier aus.“ (287)
Spenglers Vorwegnahme des Existenzialismus, der mit Jean-Paul Sartre die Welt erblickt hat, darf nicht als mangelnde Systematik ausgelegt werden (zumal die System-Philosophie mit Hegel ihre Vollendung und somit auch ihr Ende erreicht hat), sondern als stärke seiner morphologischen Denkungsart, die zwar manchmal amorph (und damit ominös) bleibt, oft aber bis ins Wesen historischer Phänomene vordringt (z.B. Das Kapitel „Das Geld“, in dem Spengler das Wesen des Geldes offenbart, ein Jahrhundert, bevor viele kritische Ökonomen dies in detaillierten Analysen offenlegten, während die Masse der Menschheit das Wesen des Geldes immer noch nicht versteht.)
Zum Verständnis Spenglers sind seine Unterscheidungen von Richtung und Ausdehnung, sowie Werden und Gewordenem von Bedeutung: „Symbole, als etwas Verwirklichtes, gehören zum Bereich des Ausgedehnten. Sie sind geworden, nicht werdend – auch wenn sie ein Werden bezeichnen – mithin starr begrenzt und den Gesetzen des Raumes unterworfen.“ (285) Symbole sind die Pyramiden Ägyptens oder gotische Kathedralen. Zwar sind sie von Menschen gemacht, aber wie ein Felsen bereits statisch geworden. Das Gewordene ist die Vollendung eines Werdenden. Das Gewordene ist Ausgedehnt im Raum, Teil des Raums. Das Werdende (der Prozess der Errichtung von Pyramiden und Kathedralen) ist in der Vergangenheit geschehen, in einer Zeit, die in einer unumkehrbaren Richtung verlaufen ist.
Alles Gewordene ist statisch, aber auch vergänglich. Das gilt für Denkmäler genauso wie für die Kulturen, deren Geist Denkmäler wie Pyramiden oder Kathedralen symbolisieren: „Alles Gewordne ist vergänglich. Vergänglich sind nicht nur Völker, Sprachen, Rassen, Kulturen. Es wird in wenigen Jahrhunderten keine westeuropäische Kultur, keinen Deutschen, Engländer, Franzosen mehr geben, wie es zur Zeit Justinians keinen Römer mehr gab. […] Vergänglich ist jeder Gedanke, jeder Glaube, jede Wissenschaft, sobald die Geister erloschen sind, in deren Welten ihre ‚ewigen Wahrheiten‘ mit Notwendigkeit als wahr empfunden wurden.“ (288 f)
Damit folgt Spengler der Philosophie Nietzsches: „Es ist nicht mehr als ein moralisches Vorurteil, dass Wahrheit mehr wert ist als Schein; es ist sogar die schlechtest bewiesene Annahme, die es in der Welt gibt.“ (Nietzsche, Werke III). Es gehört heute zu den allgemein anerkannten Voraussetzungen der Wissenschaften, dass deren Forschung „Jenseits von Gut und Böse“ ohne Wertung, im Sinne Nietzsches a-moralisch vorzugehen hat. Es gilt geradezu als Tabu über Wahrheit zu sprechen. „Es gibt keine Wahrheit“, ist die letzte Wahrheit. Anstelle der absoluten Wahrheit jedoch ist nicht die Vielfalt getreten, nicht das „Pendeln der Meinungen“ (Konrad Lorenz), oder Offenheit im Diskurs von Pro und Contra, sondern die Deutungshoheit. Diese unterliegt keinem offenen, redlichen wissenschaftlichen Diskurs, sondern einzig und allein dem Machtapparat.
Aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es um die Frage von Raum und Zeit, sowie immergültige Wahrheiten, die Immanuel Kant in Begriffen a priori gefasst hat. Mehr als an allen anderen Philosophen arbeitet sich Spengler an Kant ab. Auch wenn der Mathematiker respektlos anmerkt „Kant ist als Mathematiker bedeutungslos“ (583), was man gleichermaßen über Kant als Botaniker oder Kant als Ornithologen sagen könnte, so ist es Spengler doch ein tiefliegendes Bedürfnis, die eigene Denkungsart an der Erkenntnistheorie Kants zu messen. Kant ist sein Maßstab, nicht Hegel, die „Kritik der reinen Vernunft“, nicht die „Phänomenologie des Geistes“. Am Ende steht Spengler der „Vernunft“ Kants näher als dem „Weltgeist“ Hegels.
„Nun hat Kant die große Frage, ob dies Element »a priori« vorhanden oder durch Erfahrung erworben ist, durch seine berühmte Formel dahin zu entscheiden geglaubt, daß der Raum die allen Welteindrücken zugrunde liegende Form der Anschauung sei.“ (291)
„Es ist keine Frage, daß »der« Raum, wie ihn Kant mit unbedingter Gewißheit um sich sah, als er über seine Theorie nachdachte, für seine Vorfahren zur Karolingerzeit auch nicht annähernd in dieser strengen Gestalt vorhanden war. Kants Größe beruht auf der Schöpfung des Begriffs einer »Form a priori«, aber nicht auf der Anwendung, die er ihm gab. Daß die Zeit keine Form der Anschauung ist, daß sie überhaupt keine »Form« ist – es gibt nur ausgedehnte Formen – und nur als Gegenbegriff zum Raum definiert wurde, sahen wir schon. Es ist aber nicht nur die Frage, ob gerade das Wort Raum den formalen Gehalt im Angeschauten genau deckt; es ist auch eine Tatsache, daß die Form der Anschauung sich mit dem Grade der Entfernung ändert: Jedes entfernte Gebirge wird als Fläche – Kulisse – »angeschaut«. Niemand wird behaupten, daß er die Mondscheibe körperhaft sehe. Der Mond ist für das Auge eine reine Fläche, und erst durch das Fernrohr stark vergrößert – also künstlich angenähert – erhält er mehr und mehr räumliche Beschaffenheit. Augenscheinlich ist die Form der Anschauung also auch eine Funktion des Abstandes. Dazu kommt, daß wir beim Nachdenken, statt uns eben vergangener Eindrücke genau zu erinnern, das Bild des von ihnen abgezogenen Raumes »vor uns hinstellen«. Aber diese Vorstellung täuscht uns über die lebendige Wirklichkeit. Kant hat sich täuschen lassen. Er hätte zwischen Formen der Anschauung und des Verstandes gar nicht scheiden dürfen, denn sein Begriff Raum umfaßt bereits beides.
Wie Kant sich das Zeitproblem dadurch verdarb, daß er es zu der in ihrem Wesen mißverstandenen Arithmetik in Beziehung brachte und also von einem Zeitphantom redete, dem die lebendige Richtung fehlte, das also nur ein räumliches Schema war, so verdarb er sich das Raumproblem durch seine Beziehung auf eine Allerweltsgeometrie. Der Zufall hat es gewollt, daß wenige Jahre nach Vollendung seines Hauptwerkes Gauß die erste der nichteuklidischen Geometrien entdeckte, durch deren in sich widerspruchslose Existenz bewiesen wurde, daß es mehrere streng mathematische Arten einer dreidimensionalen Ausgedehntheit gibt, die sämtlich »a priori gewiß« sind, ohne daß es möglich wäre, eine von ihnen als die eigentliche Form der »Anschauung« herauszuheben.“ (292 f)
Spenglers Weltbild: „Alles Gewordene ist vergänglich. […] Vergänglich ist jeder Gedanke, jeder Glaube, jede Wissenschaft, sobald die Geister erloschen sind, in deren Welten ihre »ewigen Wahrheiten« mit Notwendigkeit als wahr empfunden wurden. […] Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. So führt diese Einsicht unvermerkt auf das Raumproblem, allerdings in einem neuen und überraschenden Sinne. Seine Lösung – oder bescheidener, seine Deutung – erscheint erst in diesem Zusammenhange möglich, so wie das Zeitproblem erst aus der Schicksalsidee faßlicher wurde. Das schicksalhaft gerichtete Leben erscheint, sobald wir erwachen, im Sinnenleben als empfundene Tiefe. […] Das Welterlebnis knüpft sich ausschließlich an das Wesen der Tiefe – der Ferne oder Entfernung – deren Zug im abstrakten System der Mathematik neben Länge und Breite als »dritte Dimension« bezeichnet wird. […] Die Tiefe repräsentiert den Ausdruck, die Natur; mit ihr beginnt die »Welt«. […] Natur ist eine Funktion der jeweiligen Kultur. (290 f) [Hervorhebungen fett von HTH, Hervorhebungen kursiv von Spengler.]
Angesichts der Tiefe dieser Ausführungen ist erstaunlich, welchen Missverständnissen Spengler aufgrund oberflächlicher Kant-Lektüre aufsitzt.
Kants Weltbild: Folgende Formulierungen verwendet Kant in der „Kritik der reinen Vernunft. Der transzendentalen Ästhetik erster Abschnitt. a. [Vorbemerkung: „Ästhetik“ bedeutet nicht „Lehre vom Schönen“, sondern bezieht sich auf den ursprünglichen griechischen Begriff αἴσθησις aísthēsis „Wahrnehmung, Empfindung“.]
+ Der Raum ist kein empirischer Begriff.
+ Der Raum ist eine notwendige Vorstellung a priori, die allen äußeren Anschauungen zum Grunde liegt. […] Er wird also als die Bedingung der Möglichkeit der Erscheinungen, und nicht als eine von ihnen abhängende Bestimmung angesehen und ist eine Vorstellung a priori, die notwendigerweise äußeren Erscheinungen zum Grunde liegt.
+ Der Raum ist […] eine reine Anschauung.
In späteren Kapiteln schreibt Kant:
+ Der Gebrauch dieses Begriffs [Raum] geht in dieser Wissenschaft [Geometrie] auch nur auf die äußere Sinnenwelt, von welcher der Raum die reine Form ihrer Anschauung ist, […]
+ … die Anschauungsformen Raum und Zeit.
Die gleichen Axiome, die Kant für den Raum aufgestellt hat, gelten auch für Anschauung und Vorstellung der Zeit. Spenglers fixiert sich einseitig auf den Begriff „Anschauungsform“, den er in Bezug auf die Zeit mit der banalen Erklärung „es gibt nur ausgedehnte Formen“ zurückweist. Diese Reduktion des Begriffs der „Form“ ist möglich aber banal, denn es gibt die formale Logik, es gibt in der Musik u.a. die Sonaten-Form, es gibt im täglichen Leben Umgangs-Formen und viele Formen mehr, die allesamt „ausdehnungslos“ sind. Spenglers ebenso banale Raum-Kritik beruht auf einer simplen Verwechslung: „Tatsache [ist], daß die Form der Anschauung sich mit dem Grade der Entfernung ändert.“ Richtig ist: nicht die Anschauung (d.h. nicht die „Anschauungsform Raum“), sondern das Angeschaute ändert sich mit dem Grad der Entfernung. Spengler verwechselt also einen philosophischen Begriff (das Phänomen Anschauung, die Anschauung an sich) und die menschliche Wahrnehmung eines Berges, der seine „Form“ mit zunehmender Entfernung, aber auch mit Lichteinfall und Perspektive, ändert. Jedes Kind versteht, dass der Berg nicht seine Form an sich, sondern mit zunehmender Entfernung nur das Aussehen ändert. Die subjektive Wahrnehmung des Berges (die sinnliche Wahrnehmung des Angeschauten) ändert sich, nicht Form (oder Wesen) der Anschauung.
Kant verwendet den Begriff „Anschauung“ meistens im Zusammenhang von „sinnlicher Anschauung“ synonym zu „empirischer Erfahrung“. Dazu zählt die zufällige Beobachtung der Natur ebenso wie die zielgerichtete, wissenschaftliche Erforschung der Natur. Es klingt daher widersprüchlich, wenn Kant plötzlich Raum und Zeit als „reine Anschauungen“ bezeichnet, da der Begriff „rein“ immer bedeutet: losgelöst von der empirischen Erfahrung, somit auch von der „sinnlichen Anschauung“. Spengler hat diesen Widerspruch gefühlt, verbeißt sich aber auf seine irrige Interpretation: „Raum = reine Anschauungsform“.
Es stimmt, dass Kant seine Begriffe nicht immer exakt abgrenzt, was auch gar nicht möglich ist. Die „Kritik“ ist kein fertiges Produkt, sondern der gesamte Entwicklungsprozess von Kants Epistemologie (Erkenntnis-Lehre). Kant hätte sicher weniger Verwirrung gestiftet, wenn er nicht verkürzt von „reinen Anschauungen Raum und Zeit“ gesprochen hätte, sondern wenn er explizit erklärt hätte, was tatsächlich gemeint war: Raum und Zeit sind reine Begriffe a priori und Bedingung der Möglichkeit jeder sinnlichen Anschauung und Empfindung.
Bei der Lektüre von Kant fällt auf, dass der Philosoph zahlreiche Begriffe verwendet, die nicht von vornherein eindeutig definiert werden, ganz im Gegenteil: Die Bedeutungen von Begriffen liegen nicht eindeutig vor, sondern werden von Kant ergründet, entwickelt und erfasst. Das ist das Prinzip der kritischen Methode im Unterschied zu einer Analyse, die in eindeutigen Definitionen endet. Die kritische Methode ist konstruktiv, aufbauend und offen, die analytische Methode ist definitiv, eingrenzend und ausgrenzend. Nur so kann man den vielfach missverstandenen Satz verstehen: „Der Verstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor“ (Prolegomena § 36). Dieser umstrittene Satz korreliert mit der streitbaren Aussage Spenglers: "Natur ist eine Funktion der jeweiligen Kultur."
Versuch einer Einordnung der Schlüsselbegriffe der Kritik der reinen Vernunft:
Anschauung ist jede Form des Schauens: vom beiläufigen (unwillkürlichen) Schauen während eines Spaziergangs bis zum konzentrierten, systematischen Beobachten eines Gegenstandes. Gegenstand ist alles, was dem Menschen (Subjekt) gegenüber oder entgegen steht (Objekt). Alle Anschauungen sind sinnlich und daher a posteriori.
Wahrnehmung ist die zielgerichtete Anschauung eines Gegenstandes aus einer bestimmten Perspektive (optisch, physikalisch, biologisch) und setzt entsprechende Begriffe (einfache Definitionen) voraus: Das ist ein Stein. Das ist eine Blume. Wahrnehmung impliziert nicht nur Anschauung, den Sehsinn, sondern alle Sinne. Man kann einen Gegenstand dann wahrnehmen, wenn man ihn im buchstäblichen Sinne angreifen und somit begreifen kann. Durch die Wahrnehmung entwickeln wir Begriffe, durch die Begriffe nehmen wir Gegenstände wahr. Alle Wahrnehmungen sind a posteriori.
Erkenntnis ist das Ergebnis einer Abfolge von Anschauungen und Wahrnehmungen, die geprüft (falsifiziert oder verifiziert) wurden. Anschauung, und Wahrnehmung sind Vorstufen der Erkenntnis, die Kant auch „Erfahrungserkenntnis“ oder ganz einfach „Erfahrung“ nennt. Davon abzugrenzen sind Vernunfterkenntnisse (laut Kant das ganze obere Erkenntnisvermögen). Die Form einer Erkenntnis ist ein Satz. Es ist klar, dass nicht jeder Satz eine Erkenntnis darstellt. Ganz im Gegenteil, die meisten Sätze sind (unbegründete) Behauptungen, Meinungen, Vorurteile, (willkürliche) Vermutungen, Absichts- oder Willenserklärungen, Appelle, Befehle, Vorschriften oder (systematische) Spekulationen.
Empfindung ist die unmittelbare Wahrnehmung von unfassbaren Gegenständen, d.h. von Gegenständen außerhalb unserer Reichweite. Gegenstand der Empfindung ist die Erscheinung, prototypisch für die Erscheinung ist die Sonne! Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter – das sind unmittelbare Empfindungen. Diese brauchen keine Vermittlung durch Eltern, Lehrer oder gar Wissenschafter. Unmittelbare Empfindungen brauchen auch keine Begriffe. Auch Tiere und Pflanzen empfinden Sonnenaufgang und -untergang und richten ihr Leben danach aus, genau so wie die Menschen trotz aller Erkenntnisse, die dieser Empfindung widersprechen. Empfindungen sind weder a posteriori, noch a priori, sie sind unmittelbar. Empfindungen die man vermittelt (anderen Menschen mitteilt) sind selbst keine Empfindungen, sondern Erzählungen (große Erzählungen wie die Religionen, Mythen und Sagen, oder kleine, wie „Narrative“ – so der moderne Ausdruck für subjektive Wahrheiten oder gar Lügen, die uns Politiker täglich erzählen, wenn sie ihr eigenes Handeln mystifizieren oder tabuisieren.)
Erlebnis kommt im Unterschied zur Empfindung von innen. Man kann spricht von Schmerz-Empfindung, wenn ein äußeres Ereignis bei einem Menschen Schmerz auslöst. Wenn ein Mensch stirbt, kann dieses Ereignis bei seinen nächsten Verwandten Schmerzempfindungen auslösen – doch hier ist der konventionelle Sprachgebrauch ungenau. Genauer gesagt ist dieser Schmerz ein inneres Gefühl, das Gefühl der Trauer. Dieses Gefühl kommt aber von innen, dieses Gefühl erleben nur jene Menschen, die mit dem Verstorbenen eine innere Beziehung hatten. Wer den Verstorbenen nur „aus der Ferne“, äußerlich kannte, kann den Schmerz der Trauer in dem Fall nicht erleben, sondern nur mit einzelnen Hinterbliebenen, mit denen er persönlich verbunden ist, mitfühlen. Trauer und Freude, Gefühle und Mitgefühle kann man nur erleben, nicht empfinden – bestenfalls als Schauspieler nach-empfinden (= nachahmen). Erlebnisse sind Affekte (Gefühlsregungen), die – so wie metaphysische Spekulationen oder Glaubenssätze – nicht der Erkenntnis zugänglich sind (hier sind die Grenzen der Erkenntnis erreicht). Es gibt alltägliche Erlebnisse, von denen wir die meisten schnell wieder vergessen, und prägende Erlebnisse, die unser Verhalten und unsere Haltung beeinflussen. Die äußere Form des Erlebnisses ist das Ereignis.
Vorstellung ist „das Vermögen, einen Gegenstand auch ohne dessen Gegenwart in der Anschauung vorzustellen“. Genau genommen definiert Kant mit dieser Formulierung die „Einbildungskraft“ und stiftet Verwirrung, indem er zwischen reiner und sinnlicher Vorstellung unterscheidet. Vorstellung und Einbildung sind bei Kant Synonyme, ebenso Vorstellungskraft und Einbildungskraft. Kant spricht vom Vorstellungsvermögen, nicht aber vom „Wahrnehmungsvermögen“. Den fallenden Apfel kann jeder mit offenen Augen wahrnehmen. Dazu ist keine Fähigkeit (kein Vermögen) erforderlich. Die Vorstellung von einem fallenden Apfel kann mit geschlossenen Augen erfolgen und impliziert das Wissen, warum er fällt (Kausalitätsprinzip + Schwerkraft). Die Vorstellung kann auch bloße Erinnerung sein, das Vorstellungsvermögen bleibt aber nicht beim „inneren Film“ stehen, sondern kann dazu führen, dass sich ein Farmer überlegt, wann und wie er die Äpfel erntet, bevor sie vom Baum fallen und am Boden verderben. Einbildungskraft im heutigen Verständnis ist stärker mit dem Wort Phantasie verwandt als zu Zeiten Kants, der Phantasie nur den Künstlern zugestand. So wie Wahrnehmung mit Begreifen und Begriffen verbunden ist, ist die Vorstellung mit Bildern und Symbolen verknüpft. Die Vorstellungskraft von Technikern findet ihren Ausdruck in Plänen und Programmen; das Symbol der Technik ist der Print. Die Vorstellungskraft von Unternehmern findet ihren Ausdruck in Organisationen, die Symbole der Unternehmen sind ihre Logos. Bilder, Pläne, Symbole und Logos sind dazu da, ganz bestimmte Vorstellungen bei jedem, der sie sieht und versteht, auszulösen.
Urteil ist die letzte, abschließende Form der Erkenntnis, genauer gesagt: das abschließende Ergebnis eines Erkenntnisprozesses. Wie das Urteil eines Gerichtsprozess zeigt, ist ein Urteil zwar abschließend, aber niemals endgültig, solange es noch eine höhere Instanz gibt. Höhere Instanzen finden wir auch in der Naturwissenschaft und in der Geschichtsschreibung. Hier treffen sich die Weltanschauungen von Kant und Spengler wieder. Die höhere Instanz der Wissenschaften ist der Fortschritt (Naturwissenschaften, Kant) oder die organische Entwicklung einer Kultur (Geschichte, Spengler). Höhere Instanzen sind (im Idealfall) natürliche Autoritäten (Natur und Kultur), die aber in der Realität oft durch politische Autoritäten (im schlimmsten Fall Willkürherrscher), außer Kraft gesetzt werden.
Dies ist das „kleine Einmaleins“ zum Verständnis des Erkenntnisvermögens der Menschen. Aller Menschen? Aller Menschen, die der abendländischen Zivilisation anghören. Nicht enthalten sind im „kleinen Einmaleins“ weitere Schlüsselbegriffe (Keywords) der Kritik der reinen Vernunft, von denen die wichtigsten sind (zitiert nach Ausgabe 1971, Felix Meiner Verlag): Ästhetik, Analytik, Anschauung, Antizipation, Antinomie, Antithetik, a priori, a postriori, Apperzeption, Assoziation, Axiom, Bedingung, Begriff, Bestimmung, Beweis, Bewusstsein, Dasein, Deduktion, Definition, Deklaration, Demonstration, Denken, Dependenz, Dialektik, [Dialog fehlt], Diskurs, Dogma, Doktrin, Dualismus, Dynamik, Einfluss, Einheit, Empirismus, Erfahrung, Erkenntnis, [Erlebnis fehlt], Erörterung, Erscheinung, Existenz, Form, Funktion, Gattung, [Gedächtnis und Erinnerung fehlen] Gegenstand, Gesetz, Glaube, Gott, Grundsatz, Gut, Gültigkeit, Handlung, Harmonie, Heuristik, Hypothese, Ich, Ideal, Idealismus Idee, Identität Illusion, Imperativ, Inhärenz, Intelligenz, Interesse, Kanon, Kategorien, Kausalität, Konstruktion, Kontinuität, Kosmologie, Kritik, Kultur, Leitfaden, Logik, Materie, Materialismus, Mathematik, Maxime, Metaphysik, Methode, Modalität, Möglichkeit, Moment, Monaden, Moral, Mythos, Natur, Naturgesetze, Negation, Nichts, Notwendigkeit, Objekt, Organ, Ort, Paralogismus, Phänomen, Philosophie, Physik, Physiologie, Position, Postulat, Prinzipien, Progress, Psychologie, Qualität, Quantität, Rationalismus, Raum, Realismus, Realität, Regel, rein, Relation, Religion, Schein, Schema, Schematismus, Seele, Selbstbewusstsein, Sinnenwelt, Sinnlichkeit, Sittlichkeit, Skeptizismus, Spezifikation, Spekulation, Spiritualismus, Spontaneität, Subjekt, Substanz, Synthesis, System, Teleologie, Theologie, Thesis, Totalität, transzendental, Überlegung, Überzeugung, Unendlichkeit, Unsterblichkeit, Urbild, Urgrund, Ursache, Urteil, Urteilskraft, Veränderung, Vernunft, Vernunftbegriffe, Verstand, Vorstellung, Vollkommenheit, Wahrheit, Wahrnehmung, Wahrscheinlichkeit, Welt, Widerspruch, Willkür, Wirklichkeit, Wissenschaft, Zahl, Zeit, Zufälligkeit, Zweck
Drittes Kapitel
MAKROKOSMOS
I. Die Symbolik des Weltbildes und das Raumproblem
Abschnitt 2 (zitiert nach Projekt Gutenberg, Hervorhebungen HTH)
Symbole, als etwas Verwirklichtes, gehören zum Bereich des Ausgedehnten. Sie sind geworden, nicht werdend – auch wenn sie ein Werden bezeichnen – mithin starr begrenzt und den Gesetzen des Raumes unterworfen. Es gibt nur sinnlich-räumliche Symbole. Schon das Wort Form bezeichnet etwas Ausgedehntes im Ausgedehnten, und davon machen auch, wie wir sehen werden, die inneren Formen der Musik keine Ausnahme. Ausdehnung aber ist das Merkmal der Tatsache »Wachsein«, die nur eine Seite des Einzeldaseins bildet und mit dessen Schicksalen innerlichst verbunden ist. Deshalb ist jeder Zug des tätigen – empfindenden oder verstehenden – Wachseins in dem Augenblick, wo wir ihn bemerken, bereits vergangen. Wir können über Eindrücke nur nachdenken, wie es mit bezeichnender Wendung heißt, aber was für das Sinnenleben der Tiere nur vergangen ist, ist für das wortgebundene Verstehen des Menschen vergänglich. Vergänglich ist nicht nur, was geschieht – denn kein Geschehnis läßt sich zurückrufen –, sondern auch jede Art von Bedeutung. Man verfolge das Schicksal der Säule, vom ägyptischen Grabtempel an, wo sie in Reihen den Wanderer geleitet, über den dorischen Peripteros, dessen Körper sie zusammenhält, und die früharabische Basilika, deren Innenraum sie stützt, bis zu den Fassaden der Renaissance, an welchen sie den aufstrebenden Zug zum Ausdruck bringt. Die Bedeutung von ehemals kehrt nie wieder. Was in das Reich des Ausgedehnten trat, hat mit dem Anfang auch ein Ende.
Es besteht ein tiefer und früh gefühlter Zusammenhang zwischen Raum und Tod.
Der Mensch ist das einzige Wesen, welches den Tod kennt.
Alle andern werden älter, aber mit einer durchaus auf den Augenblick eingeschränkten Bewußtheit, die ihnen ewig erscheinen muß. Sie leben, aber sie wissen nichts vom Leben wie die Kinder in den frühesten Jahren, wo das Christentum sie noch als »unschuldig« betrachtet. Und sie sterben und sehen das Sterben, aber sie wissen nicht darum. Erst der ganz erwachte, der eigentliche Mensch, dessen Verstehen durch die Gewohnheit des Sprechens vom Sehen abgehoben ist, besitzt außer der Empfindung auch einen Begriff des Vergehens, das heißt ein Gedächtnis für das Vergangene und eine Erfahrung von Unwiderruflichem. Wir sind die Zeit,Vgl. Bd. I, S. 158f. aber wir besitzen auch ein Bild der Geschichte, und in diesem erscheint im Hinblick auf den Tod die Geburt als das andre Rätsel. Für alle übrigen Wesen verläuft das Leben ohne Ahnung seiner Grenzen, das heißt ohne ein Wissen um Aufgabe, Sinn, Dauer und Ziel. Mit tiefer und bedeutungsvoller Identität knüpft sich deshalb das Erwachen des Innenlebens in einem Kinde oft an den Tod eines Verwandten. Es begreift plötzlich den leblosen Leichnam, der ganz Stoff, ganz Raum geworden ist, und zugleich fühlt es sich als einzelnes Wesen in einer fremden, ausgedehnten Welt. »Vom fünfjährigen Knaben bis zu mir ist nur ein Schritt.
Vom Neugeborenen bis zum fünfjährigen Kinde ist eine schreckliche Entfernung«, hat Tolstoi einmal gesagt. Hier, in diesem entscheidenden Punkt des Daseins, wo der Mensch erst zum Menschen wird und seine ungeheure Einsamkeit im All kennen lernt, enthüllt sich die Weltangst als die rein menschliche Angst vor dem Tode, der Grenze in der Welt des Lichts, dem starren Raum. Hier liegt der Ursprung des höheren Denkens, das zuerst ein Nachdenken über den Tod ist. Jede Religion, jede Naturforschung, jede Philosophie geht von hier aus. Jede große Symbolik heftet ihre Formensprache an den Totenkult, die Bestattungsform, den Schmuck des Grabes.
Der ägyptische Stil beginnt mit den Totentempeln der Pharaonen, der antike mit dem geometrischen Schmuck der Graburnen, der arabische mit Katakomben und Sarkophagen, der abendländische mit dem Dom, in welchem sich der Opfertod Jesu unter den Händen des Priesters täglich wiederholt. Aus der frühen Angst entspringt auch alles historische Empfinden, in der Antike durch Klammern an die lebenerfüllte Gegenwart, in der arabischen Welt aus der Taufe, die das Leben neu gewinnt und den Tod überwindet, in der faustischen aus der Buße, die den Leib Jesu zu empfangen würdigt und damit die Unsterblichkeit. Erst aus der stets wachen Sorge um das Leben, das noch nicht vergangen ist, entsteht die Sorge um das Vergangne. Ein Tier hat nur Zukunft, der Mensch kennt auch die Vergangenheit. Mit einer neuen »Weltanschauung«, das heißt einem plötzlichen Blick auf den Tod als dem Geheimnis der erschauten Welt, erwacht deshalb jede neue Kultur. Als um das Jahr 1000 der Gedanke an das Weltende sich im Abendland verbreitete, wurde die faustische Seele dieser Landschaft geboren.
Der Urmensch, in tiefem Staunen über den Tod, suchte diese Welt des Ausgedehnten mit den unerbittlichen und stets gegenwärtigen Schranken ihrer Kausalität, voll von dunkler Allmacht, die ihn ständig mit dem Ende bedrohte, mit allen Kräften seines Geistes zu durchdringen und zu beschwören. Diese triebhafte Abwehr liegt tief im unbewußten Dasein, aber indem sie Seele und Welt erst eigentlich schuf, zerdehnte, gegeneinander stellte, bezeichnete sie die Schwelle persönlicher Lebensführung. Ichgefühl und Weltgefühl beginnen zu wirken, und alle Kultur, innere wie äußere, Haltung wie Leistung, ist nur die Steigerung dieses Menschseins überhaupt. Von hier an ist alles, was unsern Empfindungen widersteht, nicht mehr nur »Widerstand«, Sache, Eindruck wie bei Tieren und auch noch beim Kinde, sondern auch Ausdruck. Die Dinge sind nicht nur wirklich innerhalb der Umwelt, sondern sie haben, so wie sie »erscheinen«, innerhalb der Welt»anschauung« auch einen Sinn. Zuerst besaßen sie allein ein Verhältnis zum Menschen, jetzt besitzt der Mensch auch sein Verhältnis zu ihnen. Sie sind Sinnbilder seines Daseins geworden. So geht das Wesen aller echten – unbewußten und innerlich notwendigen – Symbolik aus dem Wissen des Todes hervor, in dem sich das Geheimnis des Raumes enthüllt. Alle Symbolik bedeutet eine Abwehr. Sie ist Ausdruck einer tiefen Scheu im alten Doppelsinn des Wortes: ihre Formensprache redet zugleich von Feindschaft und Ehrfurcht.
Alles Gewordne ist vergänglich. Vergänglich sind nicht nur Völker, Sprachen, Rassen, Kulturen. Es wird in wenigen Jahrhunderten keine westeuropäische Kultur, keinen Deutschen, Engländer, Franzosen mehr geben, wie es zur Zeit Justinians keinen Römer mehr gab. Nicht die Folge menschlicher Generationen war erloschen; die innere Form eines Volkes, die eine Anzahl von ihnen zu einheitlicher Gebärde zusammengefaßt hatte, war nicht mehr da. Der civis Romanus, eines der mächtigsten Symbole antiken Seins, war gleichwohl als Form nur von der Dauer einiger Jahrhunderte. Aber das Urphänomen der großen Kultur überhaupt wird einmal wieder verschwunden sein, und mit ihm das Schauspiel der Weltgeschichte, und endlich der Mensch selbst und darüber hinaus die Erscheinung des pflanzlichen und tierischen Lebens an der Erdoberfläche, die Erde, die Sonne und die ganze Welt der Sonnensysteme. Alle Kunst ist sterblich, nicht nur die einzelnen Werke, sondern die Künste selbst. Es wird eines Tages das letzte Bildnis Rembrandts und der letzte Takt Mozartscher Musik aufgehört haben zu sein, obwohl eine bemalte Leinwand und ein Notenblatt vielleicht übrig sind, weil das letzte Auge und Ohr verschwand, das ihrer Formensprache zugänglich war. Vergänglich ist jeder Gedanke, jeder Glaube, jede Wissenschaft, sobald die Geister erloschen sind, in deren Welten ihre »ewigen Wahrheiten« mit Notwendigkeit als wahr empfunden wurden. Vergänglich sind sogar die Sternenwelten, welche den Astronomen am Nil und Euphrat »erscheinen«, als Welten für ein Auge, denn unser – ebenso vergängliches – Auge ist ein anderes. Wir wissen das. Ein Tier weiß es nicht, und was es nicht weiß, ist im Erlebnis seiner Umwelt nicht vorhanden. Mit dem Bilde der Vergangenheit aber schwindet auch die Sehnsucht, dem Vergänglichen einen tieferen Sinn zu geben. Und so läßt sich der Gedanke des rein menschlichen Makrokosmos wieder an das Wort knüpfen, dem die ganze fernere Darstellung gewidmet sein soll: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.
So führt diese Einsicht unvermerkt auf das Raumproblem, allerdings in einem neuen und überraschenden Sinne. Seine Lösung – oder bescheidener, seine Deutung – erscheint erst in diesem Zusammenhange möglich, so wie das Zeitproblem erst aus der Schicksalsidee faßlicher wurde. Das schicksalhaft gerichtete Leben erscheint, sobald wir erwachen, im Sinnenleben als empfundene Tiefe. Alles dehnt sich, aber es ist noch nicht »der Raum«, nichts in sich Verfestigtes, sondern ein beständiges Sich-dehnen vom bewegten Hier zum bewegten Dort. Das Welterlebnis knüpft sich ausschließlich an das Wesen der Tiefe – der Ferne oder Entfernung – deren Zug im abstrakten System der Mathematik neben Länge und Breite als »dritte Dimension« bezeichnet wird. Diese Dreizahl gleichgeordneter Elemente ist von vornherein irreführend. Ohne Zweifel sind sie im räumlichen Welteindruck nicht gleichwertig, geschweige denn gleichartig. »Länge und Breite«, sicherlich als Erlebnis eine Einheit, keine Summe, sind, mit Vorsicht gesagt, bloße Form der Empfindung. Sie repräsentieren den rein sinnlichen Eindruck. Die Tiefe repräsentiert den Ausdruck, die Natur; mit ihr beginnt die »Welt«.
Diese der Mathematik selbstverständlich ganz fremde Unterscheidung in der Bewertung der dritten Dimension gegenüber den sogenannten beiden andern liegt auch in der Gegenüberstellung der Begriffe Empfindung und Anschauung. Die Dehnung in die Tiefe verwandelt die erste in die letzte. Erst die Tiefe ist die eigentliche Dimension im wörtlichen Sinne, das Ausdehnende.Man sollte das Wort Dimension nur in der Einzahl gebrauchen. Es gibt Ausdehnung, aber nicht Ausdehnungen.
Die Dreizahl der Richtungen ist schon eine Abstraktion und im unmittelbaren Dehnungsgefühl des Leibes (der »Seele«) nicht enthalten.
Aus dem Wesen der Richtung stammt der geheimnisvolle tierhafte Unterschied von rechts und links, und dazu kommt der pflanzenhafte Zug von unten nach oben – Erde und Himmel. Dieses ist eine traumhaft gefühlte Tatsache, jenes eine zu erlernende Wahrheit des Wachseins, die deshalb der Verwechslung unterliegen kann. Beides findet seinen Ausdruck in der Baukunst, nämlich in der Symmetrie des Grundrisses und der Energie des Aufrisses, und nur deshalb empfinden wir in der »Architektur« des uns umgebenden Raumes den Winkel von 90° als ausgezeichnet und nicht etwa den von 60°, der eine ganz andere Zahl von »Dimensionen« ergeben würde. In ihr ist das Wachsein aktiv, in den andern streng passiv. Es ist der symbolische Gehalt einer Ordnung, und zwar im Sinne einer einzelnen Kultur, der sich zutiefst in diesem ursprünglichen und nicht weiter analysierbaren Element ausspricht. Das Erlebnis der Tiefe ist – von dieser Einsicht hängt alles Weitere ab – ein ebenso vollkommen unwillkürlicher und notwendiger als vollkommen schöpferischer Akt, durch den das Ich seine Welt, ich möchte sagen zudiktiert erhält. Er schafft aus dem Strom von Empfindungen eine formvolle Einheit, ein bewegtes Bild, das nunmehr, sobald das Verstehen sich seiner bemächtigt, von Gesetzen beherrscht, dem Kausalprinzip unterworfen und mithin, als Abbild eines persönlichen Geistes, vergänglich ist.
Es besteht kein Zweifel, obwohl der Verstand sich dagegen auflehnt, daß diese Dehnung unendlicher Verschiedenheit fähig ist, nicht nur anders beim Kinde und Manne, beim Naturmenschen und Städter, Chinesen und Römer, sondern in jedem einzelnen, je nachdem er nachdenklich oder aufmerksam, tätig oder ruhend seine Welt erlebt. Jeder Künstler hat noch »die« Natur durch Farbe und Linie wiedergegeben. Jeder Physiker, der griechische, arabische, deutsche hat »die« Natur in letzte Elemente zergliedert – warum fanden sie nicht alle dasselbe? Weil jeder seine eigene Natur hat, obwohl jeder sie mit einer Naivität, die seine Lebensanschauung rettet, die ihn rettet, mit allen andern gemein zu haben glaubt. »Natur« ist ein Besitz, der durch und durch mit persönlichstem Gehalt gesättigt ist. Natur ist eine Funktion der jeweiligen Kultur.
3
Nun hat Kant die große Frage, ob dies Element »a priori« vorhanden oder durch Erfahrung erworben ist, durch seine berühmte Formel dahin zu entscheiden geglaubt, daß der Raum die allen Welteindrücken zugrunde liegende Form der Anschauung sei. Aber die »Welt« des sorglosen Kindes und des Träumers besitzt diese Form unzweifelhaft in schwankender und unentschiedener Art, [Der Mangel an Perspektive in Kinderzeichnungen wird von Kindern gar nicht empfunden.] und erst die gespannte, praktische, technische Betrachtung der Umwelt – denn frei bewegliche Wesen müssen für ihr Leben sorgen; nur die Lilien auf dem Felde brauchen es nicht – läßt das sinnliche Sich-dehnen zur verstandenen Dreidimensionalität erstarren.
Erst der städtische Mensch hoher Kulturen lebt wirklich in dieser grellen Wachheit, und erst für sein Denken gibt es einen vom Sinnenleben ganz abgelösten (»absoluten«), toten, zeitfremden Raum als Form nicht mehr des Angeschauten, sondern des Verstandenen.
Es ist keine Frage, daß »der« Raum, wie ihn Kant mit unbedingter Gewißheit um sich sah, als er über seine Theorie nachdachte, für seine Vorfahren zur Karolingerzeit auch nicht annähernd in dieser strengen Gestalt vorhanden war. Kants Größe beruht auf der Schöpfung des Begriffs einer »Form a priori«, aber nicht auf der Anwendung, die er ihm gab. Daß die Zeit keine Form der Anschauung ist, daß sie überhaupt keine »Form« ist – es gibt nur ausgedehnte Formen – und nur als Gegenbegriff zum Raum definiert wurde, sahen wir schon. Es ist aber nicht nur die Frage, ob gerade das Wort Raum den formalen Gehalt im Angeschauten genau deckt; es ist auch eine Tatsache, daß die Form der Anschauung sich mit dem Grade der Entfernung ändert:
Jedes entfernte Gebirge wird als Fläche – Kulisse – »angeschaut«. Niemand wird behaupten, daß er die Mondscheibe körperhaft sehe. Der Mond ist für das Auge eine reine Fläche, und erst durch das Fernrohr stark vergrößert – also künstlich angenähert – erhält er mehr und mehr räumliche Beschaffenheit. Augenscheinlich ist die Form der Anschauung also auch eine Funktion des Abstandes. Dazu kommt, daß wir beim Nachdenken, statt uns eben vergangener Eindrücke genau zu erinnern, das Bild des von ihnen abgezogenen Raumes »vor uns hinstellen«. Aber diese Vorstellung täuscht uns über die lebendige Wirklichkeit. Kant hat sich täuschen lassen. Er hätte zwischen Formen der Anschauung und des Verstandes gar nicht scheiden dürfen, denn sein Begriff Raum umfaßt bereits beides.
[Sein Gedanke, daß die Apriorität des Raumes durch die unbedingte anschauliche Gewißheit einfacher geometrischer Tatsachen bewiesen werde, beruht auf der schon erwähnten allzu populären Ansicht, daß Mathematik entweder Geometrie oder Arithmetik sei. Nun war schon damals die Mathematik des Abendlandes weit über dieses naive – der Antike nachgesprochene – Schema hinausgegangen. Wenn die heutige Geometrie statt »des Raumes« mehrfach unendliche Zahlenmannigfaltigkeiten zugrunde legt, unter denen die dreidimensionale ein an sich nicht ausgezeichneter Einzelfall ist, und innerhalb dieser Gruppen funktionale Gebilde hinsichtlich ihrer Struktur untersucht, so hat jede überhaupt mögliche Art von sinnlicher Anschauung aufgehört, sich formal mit mathematischen Tatsachen im Bereich solcher Ausgedehntheiten zu berühren, ohne daß deren Evidenz dadurch herabgesetzt würde. Die Mathematik ist also von der Form des Angeschauten unabhängig. Es ist nun die Frage, wie viel von der gerühmten Evidenz der Anschauungsformen für sich übrig bleibt, sobald die künstliche Übereinanderschichtung beider in einer vermeintlichen Erfahrung erkannt worden ist.]
Wie Kant sich das Zeitproblem dadurch verdarb, daß er es zu der in ihrem Wesen mißverstandenen Arithmetik in Beziehung brachte und also von einem Zeitphantom redete, dem die lebendige Richtung fehlte, das also nur ein räumliches Schema war, so verdarb er sich das Raumproblem durch seine Beziehung auf eine Allerweltsgeometrie. Der Zufall hat es gewollt, daß wenige Jahre nach Vollendung seines Hauptwerkes Gauß die erste der nichteuklidischen Geometrien entdeckte, durch deren in sich widerspruchslose Existenz bewiesen wurde, daß es mehrere streng mathematische Arten einer dreidimensionalen Ausgedehntheit gibt, die sämtlich »a priori gewiß« sind, ohne daß es möglich wäre, eine von ihnen als die eigentliche Form der »Anschauung« herauszuheben.
Es war ein schwerer und für einen Zeitgenossen Eulers und Lagranges unverzeihlicher Irrtum, die antike Schulgeometrie, denn an sie hat Kant immer gedacht, in den Formen der uns umgebenden Natur abgebildet finden zu wollen. In den Augenblicken, wo wir sie aufmerksam beobachten, ist in der Nähe des Beobachters und bei hinreichend kleinen Verhältnissen eine annähernde Übereinstimmung zwischen dem lebendigen Eindruck und den Regeln der gewöhnlichen Geometrie sicherlich vorhanden. Die von der Philosophie behauptete genaue Übereinstimmung läßt sich aber weder durch den Augenschein noch durch Meßinstrumente nachweisen. Beide können eine gewisse, für die praktische Entscheidung über die Frage z. B., welche der nichteuklidischen Geometrien die des »empirischen« Raumes sei, bei weitem nicht ausreichende Grenze der Genauigkeit niemals überschreiten. [Gewiß läßt sich ein geometrischer Lehrsatz an einer Zeichnung beweisen, richtiger demonstrieren. Aber der Lehrsatz erhält in jeder Art von Geometrie eine andre Fassung, und hier entscheidet die Zeichnung nichts mehr.]
Bei großen Maßstäben und Entfernungen, wo das Tiefenerlebnis das Anschauungsbild völlig beherrscht – vor einer weiten Landschaft etwa statt vor einer Zeichnung – widerspricht die Anschauungsform der Mathematik gründlich. Wir sehen in jeder Allee, daß Parallelen sich am Horizont berühren. Die Perspektive der abendländischen und die ganz andere der chinesischen Malerei, deren Zusammenhang mit den Grundproblemen der zugehörigen Mathematiken deutlich fühlbar wird, beruht eben auf dieser Tatsache. Das Tiefenerlebnis in der unermeßlichen Fülle seiner Arten entzieht sich jeder zahlenmäßigen Bestimmung. Die gesamte Lyrik und Musik, die gesamte ägyptische, chinesische, abendländische Malerei widersprechen laut der Annahme einer streng mathematischen Struktur des erlebten und gesehenen Raumes und nur, weil kein neuerer Philosoph von Malerei das geringste verstanden hat, konnte ihnen allen diese Widerlegung unbekannt bleiben. Der » Horizont«, in dem und durch den jedes Gesichtsbild allmählich in einen Flächenabschluß übergeht, ist durch keine Art von Mathematik zu erfassen. Jeder Pinselstrich eines Landschaftsmalers widerlegt die Behauptung der Erkenntnistheorie.
Die »drei Dimensionen« besitzen als vom Leben abgezogene mathematische Größe keine natürliche Grenze. Man verwechselt das mit Fläche und Tiefe des erlebten Eindrucks, und so setzt sich der eine erkenntnistheoretische Irrtum in den andern fort, daß auch die angeschaute Ausgedehntheit unbegrenzt sei, obwohl unser Blick nur belichtete Raumstücke umfaßt, deren Grenze die jeweilige Lichtgrenze bildet, sollte es auch der Fixsternhirnmel oder die atmosphärische Helligkeit sein. Die »gesehene Welt« ist die Gesamtheit von Lichtwiderständen, weil das Sehen an das Vorhandensein von strahlendem oder zurückgestrahltem Licht gebunden ist. Die Griechen bleiben auch dabei stehen. Nur das abendländische Weltgefühl schuf die Idee eines grenzenlosen Weltraums mit unendlichen Fixsternensystemen und Entfernungen, die weit über alle optischen Möglichkeiten hinausgeht – eine Schöpfung des inneren Blickes, die sich jeder Verwirklichung durch das Auge entzieht und Menschen anders fühlender Kulturen selbst als Gedanke fremd und unvollziehbar bleibt.
4
Das Ergebnis der Gaußschen Entdeckung, welche den Weg der modernen Mathematik überhaupt änderte, [Bekanntlich hat Gauß über seine Entdeckung bis fast an sein Lebensende geschwiegen, weil er »das Geschrei der Böoter« fürchtete.] war also der Nachweis, daß es mehrere gleich richtige Strukturen der dreidimensionalen Ausgedehntheit gibt, und die Frage, welche von ihnen denn der wirklichen Anschauung entspreche, beweist, daß man das Problem gar nicht begriffen hat. Die Mathematik beschäftigt sich, gleichviel ob sie sich anschaulicher Bilder und Vorstellungen als Handhaben bedient oder nicht, mit völlig von Leben, Zeit und Schicksal abgehobenen, rein verstandenen Systemen, Formenwelten reiner Zahlen, deren Richtigkeit – nicht Tatsächlichkeit– zeitlos und von kausaler Logik ist wie alles nur Erkannte und nicht Erlebte.
Damit ist die Verschiedenheit der lebendigen Anschauung von der mathematischen Formensprache offenbar geworden, und das Geheimnis des Raumwerdens tut sich auf.
Wie das Werden dem Gewordnen, die unaufhörlich lebende Geschichte der vollendeten und toten Natur zugrunde liegt, das Organische dem Mechanischen, das Schicksal dem kausalen Gesetz, dem objektiv Gesetzten, so ist die Richtung der Ursprung der Ausdehnung.
Das mit dem Worte Zeit berührte Geheimnis des sich vollendenden Lebens bildet die Grundlage dessen, was als vollendet durch das Wort Raum weniger verstanden als für ein inneres Gefühl angedeutet wird. Jede wirkliche Ausgedehntheit wird in und mit dem Erlebnis der Tiefe erst vollzogen; und eben jene Dehnung in die Tiefe und Ferne – zuerst für das Empfinden, vor allem das Auge, dann erst für das Denken –, der Schritt vom tiefenlosen Sinneneindruck zum makrokosmisch geordneten Weltbilde mit der geheimnisvoll in ihm sich andeutenden Bewegtheit ist das, was zunächst durch das Wort Zeit bezeichnet wird. Der Mensch empfindet sich, und das ist der Zustand wirklichen, auseinanderspannenden Wachseins, » in« einer ihn rings umgebenden Ausgedehntheit. Man braucht diesen Ureindruck des Weltmäßigen nur zu verfolgen, um zu sehen, daß es in Wirklichkeit nur eine wahre Dimension des Raumes gibt, die Richtung nämlich von sich aus in die Ferne, das Dort, die Zukunft, und daß das abstrakte System dreier Dimensionen eine mechanische Vorstellung, keine Tatsache des Lebens ist.
Das Tiefenerlebnis dehnt die Empfindung zur Welt. Das Gerichtetsein des Lebens war mit Bedeutung als Nichtumkehrbarkeit bezeichnet worden und ein Rest dieses entscheidenden Merkmals der Zeit liegt in dem Zwang, auch die Tiefe der Welt stets von sich aus, nie vom Horizont aus zu sich hin empfinden zu können. Der bewegliche Leib aller Tiere und des Menschen ist auf diese Richtung hin angelegt. Man bewegt sich » vorwärts« – der Zukunft entgegen, mit jedem Schritt nicht nur dem Ziel, sondern auch dem Alter sich nähernd – und empfindet jeden Blick rückwärts auch als den Blick auf etwas Vergangnes, bereits zur Geschichte Gewordnes.Erst von dieser Richtung in der Anlage des Leibes aus besinnt man sich auf den Unterschied v [on rechts und links, vgl. Bd. I, S. 218, Anm. »Vorn« hat für den Körper einer Pflanze gar keinen Sinn.]
Wenn man die Grundform des Verstandenen, die Kausalität, als erstarrtes Schicksal bezeichnet, so darf die Raumtiefe eine erstarrte Zeit genannt werden. Was nicht nur der Mensch, sondern schon das Tier als Schicksal um sich walten fühlt, empfindet es tastend, sehend, horchend, witternd als Bewegung, die vor der gespannten Aufmerksamkeit kausal erstarrt. Wir fühlen: es geht dem Frühling entgegen, und wir fühlen im voraus, wie die Frühlingslandschaft sich rings um uns dehnt; aber wir wissen, daß sich die Erde im Weltraum drehend bewegt und daß die Frühlingsdauer neunzig solcher Erddrehungen – Tage – »beträgt«. Die Zeit gebiert den Raum, der Raum aber tötet die Zeit.
Hätte Kant sich schärfer gefaßt, so hätte er, statt von »zwei Formen der Anschauung« zu reden, die Zeit die Form des Anschauens, den Raum die Form des Angeschauten genannt, und dann hätte sich ihm der Zusammenhang beider vielleicht offenbart. Der Logiker, Mathematiker und Naturforscher kennt in den Augenblicken gespannten Nachdenkens nur den gewordenen, vom einmaligen Geschehen eben durch das Nachdenken darüber abgelösten, wahren, systematischen Raum, in welchem alles die Eigenschaft einer mathematisch bestimmbaren »Dauer« besitzt. Hier aber wurde angedeutet, wie der Raum unaufhörlich wird. Solange wir sinnend ins Weite blicken, webt es ringsumher. Werden wir aufgeschreckt, so spannt sich vor scharfen Augen ein fester Raum aus. Dieser Raum ist; er steht damit, daß er ist, außerhalb der Zeit, von ihr und damit vom Leben abgelöst. In ihm herrscht die Dauer, ein Stück abgestorbener Zeit, als erkannte Eigenschaft von Dingen; und da wir uns selbst als seiend in diesem Raum erkennen, so wissen wir um unsre Dauer und deren Grenzen, an die der Zeiger unsrer Uhren unaufhörlich mahnt. Der starre Raum selbst aber, der ebenfalls vergänglich ist und mit jedem Nachlassen des geistigen Gespanntseins aus dem farbigen Dehnen unsrer Umwelt verschwindet, ist eben damit Zeichen und Ausdruck des Lebens selbst, das ursprünglichste und mächtigste seiner Symbole.
Denn die wahllose Deutung der Tiefe, die mit der Wucht eines elementaren Ereignisses das Wachsein beherrscht, bezeichnet zugleich mit dem Erwachen des Innenlebens die Grenze von Kind und – Mensch. Das symbolische Erlebnis der Tiefe ist es, welches dem Kinde fehlt, das nach dem Monde greift, das noch keinen Sinn der Außenwelt kennt und gleich der urmenschlichen Seele in traumhafter Verbundenheit mit allem Empfindungshaften hindämmert. Nicht als ob ein Kind keine Erfahrung einfachster Art vom Ausgedehnten hätte; aber eine Weltanschauung ist noch nicht da; die Ferne wird empfunden, aber sie redet noch nicht zur Seele. Erst mit dem Wachwerden der Seele erhebt sich auch die Richtung zum lebendigen Ausdruck. Und da ist antik das Ruhen in der nahen Gegenwart, das sich allem Fernen und Künftigen verschließt, faustisch die Richtungsenergie, die nur für die fernsten Horizonte einen Blick hat, chinesisch das Wandeln vor sich hin, das doch einmal zum Ziele führt, und ägyptisch der entschlossene Gang auf dem einmal eingeschlagenen Wege. So offenbart sich die Schicksalsidee in jedem Lebenszuge.
Erst damit gehören wir einer einzelnen Kultur an, deren Glieder ein gemeinsames Weltgefühl und aus ihm eine gemeinsame Welt form verbindet. Eine tiefe Identität verknüpft beides: Das Erwachen der Seele, ihre Geburt zum hellen Dasein im Namen einer Kultur, und das plötzliche Begreifen von Ferne und Zeit, die Geburt der Außenwelt durch das Symbol der Dehnung, die von nun an das Ursymhol dieses Lebens bleibt und ihm seinen Stil und die Gestalt seiner Geschichte als der fortschreitenden Verwirklichung seiner innern Möglichkeiten gibt. Erst aus der Art des Gerichtetseins folgt das ausgedehnte Ursymbol, nämlich für den antiken Weltblick der nahe, fest umgrenzte, in sich geschlossene Körper, für den abendländischen der unendliche Raum mit dem Tiefendrang der dritten Dimension, für den arabischen die Welt als Höhle. Hier löst sich eine alte philosophische Frage in Nichts auf: Angeboren ist diese Urgestalt der Welt, insofern sie ursprüngliches Eigentum der Seele dieser Kultur ist, deren Ausdruck unser ganzes Leben bildet; erworben ist sie, insofern jede einzelne Seele jenen Schöpfungsakt für sich noch einmal wiederholt und das ihrem Dasein vorbestimmte Symbol der Tiefe in früher Kindheit, wie ein ausschlüpfender Schmetterling seine Flügel, entfaltet. Das erste Begreifen der Tiefe ist ein Geburtsakt, ein seelischer neben dem leiblichen. Mit ihm wird eine Kultur aus ihrer Mutterlandschaft geboren, und das wird in ihrem ganzen Verlauf von jeder einzelnen Seele wiederholt. Dies nannte Plato, indem er an einen hellenischen Urglauben anknüpfte, die Anamnesis. Die Bestimmtheit der Weltform, die für jede ertagende Seele plötzlich da ist, wird aus dem Werden gedeutet, während Kant, der Systematiker, mit seinem Begriff der apriorischen Form bei der Deutung desselben Rätsels vom toten Ergebnis, nicht vom lebendigen Wege zu ihm ausgeht.
Die Art der Ausgedehntheit soll von nun an das Ursymbol einer Kultur genannt werden. Die gesamte Formensprache ihrer Wirklichkeit, ihre Physiognomie im Unterschiede von der jeder anderen Kultur und vor allem von der beinahe physiognomielosen Umwelt des primitiven Menschen ist aus ihr abzuleiten; denn die Deutung der Tiefe erhebt sich nun zur Tat, zum gestaltenden Ausdruck in Werken, zur Umgestaltung des Wirklichen, die nicht mehr wie bei Tieren einer Not des Lebens dient, sondern ein Sinnbild des Lebens aufrichten soll, das sich aller Elemente der Ausdehnung, der Stoffe, Linien, Farben, Töne, Bewegungen bedient, und oft noch nach Jahrhunderten, indem es im Weltbild späterer Wesen auftaucht und seinen Zauber übt, von der Art zeugt, wie seine Urheber die Welt verstanden haben.
Aber das Ursymbol selbst verwirklicht sich nicht. Es ist im Formgefühl jedes Menschen, jeder Gemeinschaft, Zeitstufe und Epoche wirksam und diktiert ihnen den Stil sämtlicher Lebensäußerungen. Es liegt in der Staatsform, in den religiösen Mythen und Kulten, den Idealen der Ethik, den Formen der Malerei, Musik und Dichtung, den Grundbegriffen jeder Wissenschaft, aber es wird nicht durch sie dargestellt. Folglich ist es auch durch Worte nicht begrifflich darstellbar, denn Sprachen und Erkenntnisformen sind selbst abgeleitete Symbole. Jedes Einzelsymbol redet von ihm, aber zum inneren Gefühl, nicht zum Verstand. Wenn das Ursymbol der antiken Seele fortan als der stoffliche Einzelkörper, das der abendländischen als der reine, unendliche Raum bezeichnet wird, so darf nie übersehen werden, daß Begriffe das nie zu Begreifende nicht darstellen, daß vielmehr die Wortklänge nur ein Bedeutungsgefühl davon erwecken können.
Der unendliche Raum ist das Ideal, welches die abendländische Seele immer wieder in ihrer Umwelt gesucht hat. Sie wollte es in ihr unmittelbar verwirklicht sehen, und dies erst gibt den unzähligen Raumtheorien der letzten Jahrhunderte jenseits aller vermeintlichen Resultate ihre tiefe Bedeutung als den Symptomen eines Weltgefühls. Inwiefern liegt die grenzenlose Ausgedehntheit allem Gegenständlichen zugrunde? Kaum ein zweites Problem ist so ernsthaft durchdacht worden, und fast hätte man glauben sollen, es hinge jede andre Weltfrage von dieser einen nach dem Wesen des Raumes ab. Und ist es nicht für uns in der Tat so? Warum hat denn niemand bemerkt, daß die gesamte Antike kein Wort darüber verlor, ja daß sie nicht einmal das Wort besaß, um dies Problem genau umschreiben zu können? [Weder im Griechischen noch im Latein; τόπος; (= locus) heißt Ort, Gegend, auch Stand im sozialen Sinne, χώρα (= spatium) Abstand (»zwischen«), Distanz, Rang, auch Grund und Boden (τὰ ἐκ τῆς χώρας die Feldfrüchte); τὸ κενόν (= vacuum) bezeichnet ganz unzweideutig einen hohlen Körper, wobei der Akzent auf der Umschließung liegt. In der Literatur der Kaiserzeit, welche das magische Raumgefühl durch antike Worte wiederzugeben sucht, bedient man sich hilfloser Ausdrücke wie ὁρατὸς τόπος (»Sinnenwelt«) oder spatium inane (»unendlicher Raum«, aber auch weite Fläche; die Wurzel des Wortes spatium bedeutet schwellen, fettwerden). In der echt antiken Literatur lag das Bedürfnis einer Umschreibung nicht vor, weil die Vorstellung völlig fehlte.]
Warum schwiegen die großen Vorsokratiker? Übersahen sie etwa in ihrer Welt gerade das, was uns als das Rätsel aller Rätsel erscheint? Hätten wir nicht längst einsehen sollen, daß in diesem Schweigen gerade die Lösung lag? Wie kommt es, daß unserem tiefsten Gefühl nach »die Welt« nichts anderes ist als jener durch das Tiefenerlebnis ganz eigentlich geborene Weltraum, dessen erhabene Leere durch die in ihm verlorenen Fixsternsysteme noch einmal bestätigt wird? Hätte man dies Gefühl einer Welt einem antiken Denker auch nur begreiflich machen können? Man entdeckt plötzlich, daß dies »ewige Problem«, das Kant im Namen der Menschheit mit der Leidenschaft einer symbolischen Tat behandelte, ein rein abendländisches und im Geiste der andern Kulturen gar nicht vorhanden ist.
Was war es denn, was dem antiken Menschen, dessen Blick in seine Umwelt sicherlich nicht weniger klar war, als das Urproblem des gesamten Seins erschien? Das der ἀρχή des stofflichen Urgrundes aller sinnlich-greifbaren Dinge. Begreift man dies, so wird man dem Sinn der Tatsache nahekommen – nicht des Raumes, sondern der Frage, weshalb das Raumproblem mit schicksalhafter Notwendigkeit das der abendländischen Seele und dieser allein werden mußte.
[Das liegt, bisher unerkannt, in dem berühmten Parallelenaxiom Euklids (»Durch einen Punkt ist zu einer Geraden nur eine Parallele möglich«), dem einzigen der antiken mathematischen Sätze, der unbewiesen blieb und der, wie wir heute wissen, unbeweisbar ist. Gerade das aber macht ihn zum Dogma gegenüber aller Erfahrung und damit zum metaphysischen Mittelpunkt, zum Träger jenes geometrischen Systems. Alles andre, Axiome wie Postulate, ist nur Vorbereitung oder Folge. Dieser einzige Satz ist für den antiken Geist notwendig und allgemeingültig – und doch nicht ableitbar. Was bedeutet das? Daß er ein Symbol ersten Ranges ist. Er enthält die Struktur der antiken Körperlichkeit. Gerade dies theoretisch schwächste Glied der antiken Geometrie, gegen das sich schon in hellenistischer Zeit Widerspruch erhob, offenbart ihre Seele, und gerade dieser der Alltagserfahrung selbstverständliche Satz war es, an den sich der Zweifel des aus körperlosen Raumfernen stammenden faustischen Zahlendenkens knüpfte. Es gehört zu den tiefsten Symptomen unseres Daseins, daß wir der euklidischen Geometrie nicht etwa eine, sondern eine Mehrzahl von andern gegenüberstellen, die für uns gleich wahr, gleich widerspruchslos sind. Die eigentliche Tendenz dieser als antieuklidische Gruppe aufzufassenden Geometrien – in denen es durch einen Punkt zu einer Geraden keine, zwei oder unzählige Parallelen gibt – liegt darin, daß sie eben durch ihre Mehrzahl den körperlichen Sinn des Ausgedehnten, den Euklid durch seinen Grundsatz heilig sprach, gänzlich aufhoben, denn sie widerstrebt der Anschauung, die alles Körperliche fordert, alles rein Räumliche aber verneint. Die Frage, welche der drei nichteuklidischen Geometrien die »richtige«, der Wirklichkeit zugrunde liegende sei – obwohl selbst von Gauß ernsthaft geprüft – ist dem Weltgefühl nach antik, hätte also von einem Denker unserer Kultur nicht gestellt werden sollen. Sie verschließt den Blick in den wahren Tiefsinn jener Einsicht: Nicht in der Realität der einen oder andern, sondern in der Vielheit gleichmäßig möglicher Geometrien liegt das spezifisch abendländische Symbol. Erst durch die Gruppe von Raumstrukturen, in deren Fülle die antike Fassung einen bloßen Grenzfall bildet, wird der Rest von Körperhaftem im reinen Raumgefühl aufgelöst.]
Gerade diese allmächtige Räumlichkeit, welche die Substanz aller Dinge in sich saugt, aus sich erzeugt – unser Eigentlichstes und Höchstes im Aspekt unseres Weltalls –, wird von der antiken Menschheit, die nicht einmal das Wort und also den Begriff Raum kennt, einstimmig als τὸ μὴ ὂν abgetan, als das, was nicht da ist. Man kann das Pathos dieser Verneinung gar nicht tief genug fassen. Die ganze Leidenschaft der antiken Seele grenzte durch sie symbolisch ab, was sie nicht als wirklich empfinden wollte, was nicht Ausdruck ihres Daseins sein durfte. Eine Welt von andrer Farbe liegt plötzlich vor unsern Augen da.
Die antike Statue in ihrer prachtvollen Leibhaftigkeit, ganz Aufbau und ausdrucksvolle Fläche ohne irgend einen nichtkörperlichen Hintergedanken, enthielt für das antike Auge alles ohne Rest, was Wirklichkeit hieß. Das Stoffliche, sichtbar Begrenzte, Greifbare, unmittelbar Gegenwärtige – damit sind die Merkmale dieser Art von Ausdehnung erschöpft. Das antike Weltall, der Kosmos, die wohlgeordnete Menge aller nahen und vollkommen übersehbaren Dinge ist durch das körperliche Himmelsgewölbe abgeschlossen. Es gibt nicht mehr. Unser Bedürfnis, jenseits dieser Schale wieder »Raum« zu denken, fehlte dem antiken Weltgefühl vollständig. Die Stoiker haben sogar die Eigenschaften und Verhältnisse von Dingen für Körper erklärt. Für Chrysipp ist das göttliche Pneuma ein Körper; für Demokrit besteht das Sehen im Eindringen von stofflichen Teilchen des Gesehenen. Der Staat ist ein Körper, der aus der Summe aller Körper der Bürger besteht; das Recht kennt nur körperliche Personen und körperliche Sachen.
Und endlich findet dies Gefühl seinen erhabensten Ausdruck in dem Steinkörper des antiken Tempels. Der fensterlose Innenraum wird von der Säulenstellung sorgfältig verhehlt; außen aber befindet sich keine einzige gerade Linie. Alle Treppenstufen haben eine leise Schwingung nach außen, und zwar jede von anderem Grad. Die Giebel, der Dachfirst, die Seiten sind geschwungen. Jede Säule hat eine leichte Schwellung; keine steht vollkommen senkrecht und hat den gleichen Abstand von der nächsten. Aber Schwellung, Neigung und Abstand ändern sich von den Ecken bis zur Seitenmitte in einem sorgfältig abgetönten Verhältnis. So bekommt der ganze Körper etwas geheimnisvoll um einen Mittelpunkt Kreisendes. Die Krümmungen sind so fein, daß sie dem Auge gewissermaßen nicht sichtbar, nur fühlbar sind. Eben dadurch aber wird die Tiefenrichtung aufgehoben.
Der gotische Stil strebt, der dorische schwingt. Der Innenraum der Dome zieht mit Urgewalt empor und in die Ferne; der Tempel ist in majestätischer Ruhe hingelagert. Aber dasselbe gilt von der faustischen und der apollinischen Gottheit und nach ihrem Bilde von den Grundbegriffen der Physik. Den Prinzipien von Lage, Stoff und Form haben wir die der strebenden Bewegung, Kraft und Masse, entgegengestellt, und die letzte als das konstante Verhältnis von Kraft und Beschleunigung definiert, um beides endlich in die vollkommen raumhaften Elemente der Kapazität und Intensität zu verflüchtigen. Aus dieser Art, Wirklichkeit aufzufassen, mußte als herrschende Kunst die Instrumentalmusik der großen Meister des 18. Jahrhunderts hervorgehen, die einzige von allen Künsten, deren Formenwelt der Schauung des reinen Raumes innerlich verwandt ist. In ihr gibt es, den Bildsäulen antiker Tempelbezirke und Marktplätze gegenüber, körperlose Reiche von Tönen, Tonräume, Tonmeere; das Orchester brandet, schlägt Wellen, verebbt; es malt Fernen, Lichter, Schatten, Stürme, ziehende Wolken, Blitze, Farben von vollkommener Jenseitigkeit; man denke an die Landschaften der Instrumentation Glucks und Beethovens. »Gleichzeitig« mit dem Kanon Polyklets, jener Schrift, in welcher der große Bildhauer die strengen Regeln des Aufbaus menschlicher Körper niederlegte, die bis auf Lysipp herab herrschend geblieben sind, vollendete sich um 1740 durch Stamitz der strenge Kanon des vierteiligen Sonatensatzes, der erst in Beethovens späten Quartetten und Sinfonien sich lockert, bis endlich in der einsamen, vollkommen »infinitesimalen« Tonwelt der Tristanmusik alle irdische Greifbarkeit sich löst. Dies Urgefühl einer Lösung, Erlösung, Auflösung der Seele im Unendlichen, einer Befreiung von aller stofflichen Schwere, das die höchsten Momente unsrer Musik stets wachrufen, erlöst auch den Tiefendrang der faustischen Seele, während die Wirkung antiker Kunstwerke bindend, einschränkend, das Körpergefühl festigend ist und das Auge von der Ferne zu einer schön gesättigten Nähe und Ruhe zieht.
„Es gibt viele Moralen, aber nur eine Ethik“, schrieb der Autor des Buches „Moral 4.0“, das 2017 erschienen ist, ohne zu wissen, dass Oswald Spengler rund 100 Jahre davor bereits erkannt hatte: „Es gibt so viel Moralen, als es Kulturen gibt, nicht mehr und nicht weniger. Niemand hat hier eine freie Wahl“ (549), „eine Moral ist wie eine Plastik, Musik oder Malerei eine in sich geschlossene Formenwelt, die ein Lebensgefühl zum Ausdruck bringt, schlechthin gegeben, in der Tiefe unveränderlich, von innerer Notwendigkeit. Sie ist innerhalb ihres geschichtlichen Kreises immer wahr, außerhalb seiner immer unwahr.“ (551)
Auch für den Unterschied zwischen Moral und Ethik findet er eine Antwort: „Man hat in den Worten einen gewissen Unterschied gemacht und die Ethik eine Wissenschaft, die Moral eine Aufgabe genannt“ (550); bei dieser Position bleibt Spengler aber nicht stehen, denn er diagnostiziert im „ethischen Sozialismus“ das Symptom der Zivilisation des Abendlandes, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts begonnen hat, die Kultur des Abendlandes aufzulösen („aufzuheben“ hätte Hegel gesagt).
Zum besseren Verständnis dieser Position im Folgenden Auszüge aus dem Kapitel „Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus“; vorweg: „Jede antike Ethik ist eine Ethik der Haltung [Anm HTH: „ethos“ wird meist mit „Charakter“ übersetzt, doch ist im Sinne Spenglers ist „Haltung“ die bessere Übersetzung], jede abendländische eine Ethik der Tat.“ (552) Und eine Provokation für alle, die immer noch den politischen Konflikt zwischen „links“ und „rechts“ für relevant halten: „Wir alle sind Sozialisten, ob wir es wissen und wollen oder nicht. Selbst der Widerstand gegen ihn trägt seine Form.“
„Es gibt viele Moralen, aber nur eine Ethik“, schrieb der Autor des Buches „Moral 4.0“, das 2017 erschienen ist, ohne zu wissen, dass Oswald Spengler rund 100 Jahre davor bereits erkannt hatte: „Es gibt so viel Moralen, als es Kulturen gibt, nicht mehr und nicht weniger. Niemand hat hier eine freie Wahl“ (549), „eine Moral ist wie eine Plastik, Musik oder Malerei eine in sich geschlossene Formenwelt, die ein Lebensgefühl zum Ausdruck bringt, schlechthin gegeben, in der Tiefe unveränderlich, von innerer Notwendigkeit. Sie ist innerhalb ihres geschichtlichen Kreises immer wahr, außerhalb seiner immer unwahr.“ (551)
Auch für den Unterschied zwischen Moral und Ethik findet er eine Antwort: „Man hat in den Worten einen gewissen Unterschied gemacht und die Ethik eine Wissenschaft, die Moral eine Aufgabe genannt“ (550); bei dieser Position bleibt Spengler aber nicht stehen, denn er diagnostiziert im „ethischen Sozialismus“ das Symptom der Zivilisation des Abendlandes, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts begonnen hat, die Kultur des Abendlandes aufzulösen („aufzuheben“ hätte Hegel gesagt).
Zum besseren Verständnis dieser Position im Folgenden Auszüge aus dem Kapitel „Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus“; vorweg: „Jede antike Ethik ist eine Ethik der Haltung [Anm HTH: „ethos“ wird meist mit „Charakter“ übersetzt, doch ist im Sinne Spenglers ist „Haltung“ die bessere Übersetzung], jede abendländische eine Ethik der Tat.“ (552) Und eine Provokation für alle, die immer noch den politischen Konflikt zwischen „links“ und „rechts“ für relevant halten: „Wir alle sind Sozialisten, ob wir es wissen und wollen oder nicht. Selbst der Widerstand gegen ihn trägt seine Form.“
Fünftes Kapitel
SEELENBILD UND LEBENSGEFÜHL
I. Zur Form der Seele
II. Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus
Abschnitt 13
Als Nietzsche das Wort »Umwertung aller Werte« zum ersten Male niederschrieb, hatte endlich die seelische Bewegung dieser Jahrhunderte, in deren Mitte wir leben, ihre Formel gefunden. Umwertung aller Werte – das ist der innerste Charakter jeder Zivilisation.
Sie beginnt damit, alle Formen der voraufgegangenen Kultur umzuprägen, anders zu verstehen, anders zu handhaben. Sie erzeugt nicht mehr, sie deutet nur um.
Darin liegt das Negative aller Zeitalter dieser Art. Sie setzen den eigentlichen Schöpfungsakt voraus. Sie treten nur eine Erbschaft von großen Wirklichkeiten an.
Blicken wir auf die späte Antike und prüfen wir dort, wo das entsprechende Ereignis liegt: es hat sich innerhalb des hellenistisch-römischen Stoizismus, innerhalb des langen Todeskampfes der apollinischen Seele also zugetragen. Gehen wir von Epiktet und Marc Aurel zurück auf Sokrates, den geistigen Vater der Stoa, in dem zuerst die innere Verarmung des antiken, großstädtisch und intellektuell gewordnen Lebens ans Licht trat: zwischen ihnen liegt die Umwertung aller antiken Seinsideale. Blicken wir auf Indien. Als König Asoka lebte, um 250 v. Chr., war die Umwertung des brahmanischen Lebens vollzogen; man vergleiche die vor und nach Buddha niedergeschriebenen Teile des Vedanta. Und wir? Innerhalb des ethischen Sozialismus in dem hier festgelegten Sinne, als der Grundstimmung der in die Steinmassen der großen Städte verschlagenen faustischen Seele, ist diese Umwertung eben jetzt im Gange. Rousseau ist der Ahnherr dieses Sozialismus. Rousseau steht neben Sokrates und Buddha, den anderen ethischen Wortführern großer Zivilisationen. Seine Ablehnung aller großen Kulturformen, aller bedeutungsvollen Konventionen, seine berühmte »Rückkehr zur Natur«, sein praktischer Rationalismus lassen darüber keinen Zweifel. Jeder von ihnen hat eine tausendjährige Innerlichkeit zu Grabe getragen. Sie predigen das Evangelium der Menschlichkeit, aber es ist die Menschlichkeit des intelligenten Stadtmenschen, der die späte Stadt und mit ihr die Kultur satt hat, dessen »reine«, nämlich seelenlose Vernunft nach einer Erlösung von ihr und ihrer gebietenden Form, von ihren Härten, von ihrer innerlich nicht mehr erlebten und deshalb verhaßten Symbolik sucht. Die Kultur wird dialektisch vernichtet. Lassen wir die großen Namen des 19. Jahrhunderts vorüberziehen, an die sich für uns dies mächtige Schauspiel knüpft: Schopenhauer, Hebbel, Wagner, Nietzsche, Ibsen, Strindberg, so überblicken wir das, was Nietzsche in dem fragmentarischen Vorwort zu seinem unvollendeten Hauptwerk beim Namen nannte, die Heraufkunft des Nihilismus. Sie ist keiner der großen Kulturen fremd. Sie gehört mit innerster Notwendigkeit zum Ausgang dieser mächtigen Organismen. Sokrates war Nihilist; Buddha war es. Es gibt eine ägyptische, arabische, chinesische so gut wie eine westeuropäische Entseelung des Menschlichen. Es handelt sich nicht um politische und wirtschaftliche, nicht einmal um eigentlich religiöse oder künstlerische Verwandlungen. Es handelt sich überhaupt nicht um Greifbares, nicht um Tatsachen, sondern um das Wesen einer Seele, die ihre Möglichkeiten restlos verwirklicht hat. Man wende nicht die gewaltigen Leistungen gerade des Hellenismus und der westeuropäischen Modernität ein. Sklavenwirtschaft und Maschinenindustrie, »Fortschritt« und Ataraxia, Alexandrinismus und moderne Wissenschaft, Pergamon und Bayreuth, soziale Zustände, wie sie die »Politeia« des Aristoteles und »Das Kapital« von Marx voraussetzen, sind lediglich Symptome im historischen Oberflächenbilde. Es handelt sich nicht um das äußere Leben, um Lebenshaltung, Institutionen, Sitten, sondern um das Tiefste und Letzte, das innere Fertigsein des Weltstadtmenschen – und des Provinzlers. [Vgl. Bd. II, S. 672 f.Für die Antike trat es zur Römerzeit ein. Für uns gehört es der Zeit nach 2000 an.]
Kultur und Zivilisation – das ist der lebendige Leib eines Seelentums und seine Mumie. So unterscheidet sich das westeuropäische Dasein vor und nach 1800, das Leben in Fülle und Selbstverständlichkeit, dessen Gestalt von innen heraus gewachsen und geworden ist, und zwar in einem mächtigen Zuge von den Kindertagen der Gotik an bis zu Goethe und Napoleon, und jenes späte, künstliche, wurzellose Leben unsrer großen Städte, dessen Formen der Intellekt entwirft. Kultur und Zivilisation – das ist ein aus der Landschaft geborener Organismus und der aus seiner Erstarrung hervorgegangene Mechanismus. Der Kulturmensch lebt nach innen, der zivilisierte Mensch nach außen, im Raume, unter Körpern und »Tatsachen«. Was der eine als Schicksal fühlt, versteht der andere als Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Man ist von nun an Materialist in einem nur innerhalb einer Zivilisation gültigen Sinne, ob man es will oder nicht, und ob buddhistische, stoische, sozialistische Lehren sich in religiösen Formen geben oder nicht.
Dem gotischen und dorischen Menschen, dem Menschen der Ionik und des Barock wird die ganze ungeheure Formenwelt von Kunst, Religion, Sitte, Staat, Wissen, Gesellschaft leicht. Er trägt und verwirklicht sie, ohne sie zu »kennen«. Er besitzt dem Symbolischen der Kultur gegenüber dieselbe ungezwungene Meisterschaft, wie sie Mozart in seiner Kunst besaß. Kultur ist das Selbstverständliche. Das Gefühl einer Fremdheit unter diesen Formen, das einer Last, welche die Freiheit des Schaffens aufhebt, die Nötigung, das Vorhandene verstandesmäßig zu prüfen, um es bewußt anzuwenden, der Zwang eines für alles geheimnisvoll Schöpferische verhängnisvollen Nachdenkens sind die ersten Symptome einer ermattenden Seele. Erst der Kranke fühlt seine Glieder. Daß man eine unmetaphysische Religion konstruiert und sich gegen Kulte und Dogmen auflehnt, daß ein Naturrecht den historischen Rechten entgegengestellt wird, daß man in der Kunst Stile »entwirft«, weil der Stil nicht mehr ertragen und gemeistert wird, daß man den Staat als »Gesellschaftsordnung« auffaßt, die man ändern könne, sogar ändern müsse (neben Rousseaus »Contrat social« stehen völlig gleichbedeutende Erzeugnisse der Zeit des Aristoteles), das alles beweist, daß etwas endgültig zerfallen ist. Die Weltstadt selbst liegt als Extrem von Anorganischem inmitten der Kulturlandschaft da, deren Menschentum sie von seinen Wurzeln löst, an sich zieht und verbraucht.
Wissenschaftliche Welten sind oberflächliche Welten, praktische, seelenlose, rein extensive Welten. Sie liegen den Anschauungen des Buddhismus, Stoizismus und Sozialismus gleichmäßig zugrunde. Der erste beruht auf dem atheistischen System des Sankhya, der zweite durch Sokrates' Vermittlung auf der Sophistik, der dritte auf dem englischen Sensualismus.Das Leben nicht mehr mit kaum bewußter, wahlloser Selbstverständlichkeit leben, es als gottgewolltes Schicksal hinnehmen, sondern es als problematisch betrachten, es auf Grund intellektueller Einsichten in Szene setzen, »zweckmäßig«, »vernunftgemäß« – das ist in allen drei Fällen der Hintergrund. Das Gehirn regiert, weil die Seele abdankte. Kulturmenschen leben unbewußt, zivilisierte Menschen leben bewußt. Das im Boden wurzelnde Bauerntum vor den Toren der großen Städte, die jetzt – skeptisch, praktisch, künstlich – allein die Zivilisation repräsentieren, zählt nicht mehr mit. »Volk« – das ist jetzt Stadtvolk, anorganische Masse, etwas Fluktuierendes. Der Bauer ist nicht Demokrat – denn auch dieser Begriff gehört zum mechanischen und städtischen Dasein –, folglich übersieht, belächelt, verachtet, haßt man ihn. Er ist nach dem Schwinden der alten Stände, Adel und Priestertum, der einzige organische Mensch, ein Überbleibsel der frühen Kultur. Er findet weder im stoischen noch im sozialistischen Denken einen Platz.
So ruft der Faust des ersten Teiles der Tragödie, der leidenschaftliche Forscher in einsamen Mitternächten, folgerichtig den des zweiten Teiles und des neuen Jahrhunderts hervor, den Typus einer rein praktischen, weitschauenden, nach außen gerichteten Tätigkeit. Hier hat Goethe psychologisch die ganze Zukunft Westeuropas vorweggenommen. Das ist Zivilisation an Stelle von Kultur, der äußere Mechanismus statt des inneren Organismus, der Intellekt als das seelische Petrefakt an Stelle der erloschenen Seele selbst. So wie Faust am Anfang und Ende der Dichtung, stehen sich innerhalb der Antike der Hellene zur Zeit des Perikles und der Römer zur Zeit Cäsars gegenüber.
Abschnitt 14
Solange der Mensch einer in Vollendung begriffenen Kultur einfach vor sich hin lebt, natürlich und selbstverständlich, hat sein Leben eine wahllose Haltung. Das ist seine instinktive Moral, die sich in tausend umstrittene Formeln verkleiden mag, die man aber selbst nicht bestreitet, weil man sie hat. Sobald das Leben ermüdet, sobald man – auf dem künstlichen Boden großer Städte, die jetzt geistige Welten für sich sind – eine Theorie braucht, um es zweckmäßig in Szene zu setzen, sobald das Leben Objekt der Betrachtung geworden ist, wird die Moral zum Problem.
Kulturmoral ist die Moral, welche man hat, zivilisierte die, welche man sucht. Die eine ist zu tief, um auf logischem Wege erschöpft zu werden, die andre ist eine Funktion der Logik.
Noch bei Kant und Plato ist die Ethik bloße Dialektik, ein Spiel mit Begriffen, die Abrundung eines metaphysischen Systems. Man hätte sie im Grunde nicht nötig gehabt. Der kategorische Imperativ ist lediglich die abstrakte Fassung dessen, was für Kant gar nicht in Frage stand. Von Zenon und Schopenhauer an gilt das nicht mehr. Da mußte als Regel des Seins gefunden, erfunden, erzwungen werden, was instinktiv nicht mehr gesichert war. An dieser Stelle beginnt die zivilisierte Ethik, die nicht der Reflex des Lebens auf die Erkenntnis, sondern der Reflex der Erkenntnis auf das Leben ist.
Man fühlt etwas Künstliches, Seelenloses und Halbwahres in all diesen erdachten Systemen, welche die ersten Jahrhunderte aller Zivilisationen füllen. Das sind nicht mehr innerlichste, beinahe überirdische Schöpfungen, die ebenbürtig neben den großen Künsten stehen. Jetzt verschwindet alle Metaphysik großen Stils, alle reine Intuition vor dem einen, was plötzlich nottut, vor der Grundlegung einer praktischen Moral, die das Leben regeln soll, weil es sich selbst nicht mehr regeln kann. Die Philosophie war bis auf Kant, Aristoteles und die Lehren des Yoga und Vedanta eine Folge mächtiger Weltsysteme gewesen, in denen die formale Ethik einen bescheidnen Platz fand. Sie wird jetzt Moralphilosophie, mit einer Metaphysik als Hintergrund. Die erkenntnistheoretische Leidenschaft tritt den Vorrang an die praktische Notdurft ab: Sozialismus, Stoizismus, Buddhismus sind Philosophien dieses Stils.
Die Welt statt aus der Höhe, wie Aischylos, Plato, Dante, Goethe, unter dem Gesichtspunkt der alltäglichen Notdurft und andrängenden Wirklichkeit betrachten: das nenne ich die Vogelperspektive des Lebens mit der Froschperspektive vertauschen. Und eben das ist der Abstieg von einer Kultur zur Zivilisation.
Jede Ethik formuliert den Blick der Seele auf ihr Schicksal: heroisch oder praktisch, groß oder gemein, männlich oder greisenhaft. Und so unterscheide ich denn eine tragische und eine Plebejermoral. Die tragische Moral einer Kultur kennt und begreift die Schwere des Seins, aber sie zieht daraus das Gefühl des Stolzes, es zu tragen. So empfanden Aischylos, Shakespeare und die Denker der brahmanischen Philosophie, so Dante und der germanische Katholizismus. Das liegt in dem wilden Schlachtchoral des Luthertums: »Ein' feste Burg ist unser Gott«, und das klingt selbst noch in der Marseillaise nach. Die Plebejermoral des Epikur und der Stoa, der Sekten der Buddhazeit, des 19. Jahrhunderts macht einen Schlachtplan zurecht, das Schicksal zu umgehen. Was Aischylos groß tat, das tat die Stoa klein. Das war nicht mehr Fülle, sondern Armut, Kälte und Leere des Lebens, und die Römer haben diese intellektuelle Kälte und Leere nur zum Großartigen gesteigert. Und dasselbe Verhältnis besteht zwischen dem ethischen Pathos der großen Meister des Barock, Shakespeare, Bach, Kant, Goethe, dem männlichen Willen, innerlich Herr der natürlichen Dinge zu sein, weil man sie tief unter sich weiß, und dem Willen der europäischen Modernität, sie sich – in Gestalt der Fürsorge, der Humanität, des Weltfriedens, des Glückes der meisten – äußerlich aus dem Wege zu schaffen, weil man sich mit ihnen auf derselben Ebene sieht. Auch das ist Wille zur Macht im Gegensatz zur antiken Duldung des Unabwendbaren; auch darin liegt Leidenschaft und Hang zum Unendlichen, aber es ist ein Unterschied zwischen metaphysischer und materieller Größe im Überwinden. Die Tiefe fehlt, das, was der frühere Mensch Gott nannte. Das faustische Weltgefühl der Tat, wie es von den Staufen und Welfen bis auf Friedrich den Großen, Goethe und Napoleon in jedem großen Menschen wirksam war, verflachte zu einer Philosophie der Arbeit, wobei es für den inneren Rang gleichgültig ist, ob man sie verteidigt oder verurteilt. Der Kulturbegriff der Tat und der zivilisierte Begriff der Arbeit verhalten sich wie die Haltung des aischyleischen Prometheus zu der des Diogenes. Der eine ist ein Dulder, der andere ist faul. Galilei, Kepler, Newton brachten es zu wissenschaftlichen Taten, der moderne Physiker leistet gelehrte Arbeit. Plebejermoral auf der Grundlage des alltäglichen Daseins und des »gesunden Menschenverstandes« ist es, was trotz aller großen Worte von Schopenhauer bis zu Shaw jeder Lebensbetrachtung zugrunde liegt.
15
Jede Kultur hat mithin ihre eigene Art, seelisch zu verlöschen, und nur die eine, die aus ihrem ganzen Leben mit tiefster Notwendigkeit folgt. Deshalb sind Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus morphologisch gleichwertige Ausgangserscheinungen.
[…]
Wir haben drei Formen des Nihilismus vor uns, das Wort im Sinne Nietzsches gebraucht. Die Ideale von gestern, die seit Jahrhunderten herangewachsenen religiösen, künstlerischen, staatlichen Formen sind abgetan, nur daß selbst dieser letzte Akt der Kultur, ihre Selbstverneinung, noch einmal das Ursymbol ihres ganzen Daseins zum Ausdruck bringt. Der faustische Nihilist, Ibsen wie Nietzsche, Marx wie Wagner, zertrümmert die Ideale; der apollinische, Epikur wie Antisthenes und Zenon, läßt sie vor seinen Augen zerfallen; der indische zieht sich vor ihnen in sich selbst zurück. Der Stoizismus ist auf ein Sichverhalten des einzelnen gerichtet, auf ein statuenhaftes, rein gegenwärtiges Sein, ohne Beziehung auf Zukunft und Vergangenheit, oder auf andre. Der Sozialismus ist die dynamische Behandlung des gleichen Themas: dieselbe Verteidigung nicht auf die Haltung, sondern die Auswirkung des Lebens, aber mit einem mächtig angreifenden Zug ins Ferne auf die gesamte Zukunft und die gesamte Masse der Menschen erstreckt, die einer einzigen Methode unterworfen werden sollen; der Buddhismus, den nur ein Dilettant von Religionsforscher mit dem Christentum vergleichen kann,Und es müßte erst gesagt werden, ob mit dem Christentum der Kirchenväter oder mit dem der Kreuzzüge, denn dies sind zwei verschiedene Religionen unter derselben dogmatisch-kultischen Gewandung. Der gleiche Mangel an psychologischem Feingefühl tritt in dem beliebten Vergleich des heutigen Sozialismus mit dem Urchristentum zutage.ist durch die Worte abendländischer Sprachen kaum wiederzugeben. Aber es ist erlaubt, von einem stoischen Nirwana zu reden und auf die Gestalt des Diogenes zu verweisen; auch der Begriff eines sozialistischen Nirwana ist zu rechtfertigen, sofern man die Flucht vor dem Kampf ums Dasein ins Auge faßt, wie die europäische Müdigkeit sie in die Schlagworte Weltfriede, Humanität und Verbrüderung aller Menschen kleidet. Aber nichts von dem reicht an den unheimlich tiefen Begriff des buddhistischen Nirwana heran. Es scheint, daß die Seele alter Kulturen in den letzten Verfeinerungen und sterbend wie eifersüchtig auf ihr eigenstes Eigentum, ihren Gehalt an Form, auf das mit ihr geborene Ursymbol ist. Es gibt nichts im Buddhismus, das »christlich« sein könnte, nichts im Stoizismus, das im Islam von 1000 n. Chr. vorkommt, nichts was Konfuzius mit dem Sozialismus gemein hätte. Der Satz: si duo faciunt idem, non est idem, der an der Spitze jeder historischen Betrachtung stehen sollte, die es mit lebendigem, nie sich wiederholendem Werden und nicht mit logisch, kausal und zahlenmäßig ergreifbarem Gewordnen zu tun hat, gilt ganz besonders von diesen, eine Kulturbewegung abschließenden Äußerungen. In allen Zivilisationen wird ein durchseeltes Sein von einem durchgeistigten abgelöst, aber dieser Geist ist in jedem einzelnen Falle von andrer Struktur und der Formensprache einer andern Symbolik unterworfen. Gerade bei aller Einzigkeit des Seins, das im Unbewußten wirkend diese späten Gebilde der historischen Oberfläche schafft, ist deren Verwandtschaft der historischen Stufe nach von entscheidender Bedeutung. Was sie zum Ausdruck bringen, ist verschieden, daß sie es so zum Ausdruck bringen, kennzeichnet sie als »gleichzeitig«. Stoisch wirkt der Verzicht Buddhas, buddhistisch der stoische Verzicht auf das volle resolute Leben. Auf das Verhältnis der Katharsis des attischen Dramas zur Idee des Nirwana war oben schon hingewiesen worden. Man hat das Gefühl, als befinde sich der ethische Sozialismus, obwohl ein ganzes Jahrhundert sich schon seiner Durchbildung widmete, noch heute nicht in der klaren, harten, resignierten Fassung, die seine endgültige sein wird. Vielleicht werden die nächsten Jahrzehnte ihm die reife Formel geben, wie sie Chrysipp der Stoa gab. Aber stoisch wirkt schon heute – in den höheren, sehr engen Kreisen – seine Tendenz zur Selbstzucht und Entsagung aus dem Bewußtsein einer großen Bestimmung heraus, das römisch-preußische, ganz unpopuläre Element in ihm, und buddhistisch seine Geringschätzung eines augenblicklichen Behagens, des carpe diem; epikuräisch erscheint sicherlich das populäre Ideal, dem er ausschließlich die Wirksamkeit nach unten und in die Breite verdankt, jener Kultus der ηδονε, nicht des einzelnen für sich, sondern einzelner im Namen der Ganzheit.
Jede Seele hat Religion. Das ist nur ein anderes Wort für ihr Dasein. Alle lebendigen Formen, in denen sie sich ausspricht, alle Künste, Lehren, Bräuche, alle metaphysischen und mathematischen Formenwelten, jedes Ornament, jede Säule, jeder Vers, jede Idee ist im Tiefsten religiös und muß es sein. Von nun an kann sie es nicht mehr sein. Das Wesen aller Kultur ist Religion; folglich ist das Wesen aller Zivilisation Irreligion. Auch das sind zwei Worte für ein und dieselbe Erscheinung. Wer das nicht im Schaffen Manets gegen Velasquez, Wagners gegen Haydn, Lysippos gegen Phidias, Theokrits gegen Pindar herausfühlt, der weiß nichts vom Besten der Kunst. Religiös ist noch die Baukunst des Rokoko selbst in ihren weltlichsten Schöpfungen. Irreligiös sind die Römerbauten, auch die Tempel der Götter. Mit dem Pantheon, jener Urmoschee mit dem eindringlich magischen Gottgefühl ihres Innenraums, ist das einzige Stück echt religiöser Baukunst in das alte Rom geraten. Die Weltstädte selbst sind den alten Kulturstädten gegenüber, Alexandria gegen Athen, Paris gegen Brügge, Berlin gegen Nürnberg, in allen Einzelheiten bis in das Straßenbild, die Sprache, den trocken intelligenten Zug der GesichterMan beachte die auffallende Ähnlichkeit vieler Römerköpfe mit denen heutiger Tatsachenmenschen amerikanischen Stils und, wenn auch nicht so deutlich, mit manchen ägyptischen Porträtköpfen des Neuen Reichs. Vgl. Bd. II, S. 677f.hinein irreligiös (was man nicht mit antireligiös zu verwechseln hat). Und irreligiös, seelenlos sind demnach auch diese ethischen Weltstimmungen, die durchaus zur Formensprache der Weltstädte gehören. Der Sozialismus ist das irreligiös gewordene faustische Lebensgefühl; das besagt auch das vermeintliche (»wahre«) Christentum, das der englische Sozialist so gern im Munde führt und unter dem er etwas wie eine »dogmenlose Moral« versteht. Irreligiös sind Stoizismus und Buddhismus im Verhältnis zur orphischen und vedischen Religion, und es ist ganz Nebensache, ob der römische Stoiker den Kaiserkult billigt und ausübt, der spätere Buddhist seinen Atheismus mit Überzeugung bestreitet, der Sozialist sich freireligiös nennt oder auch »weiterhin an Gott glaubt«.
16
[… ]
Nichts ist für diese entschiedene Wendung zum äußeren Leben, das allein übrig geblieben ist, zur biologischen Tatsache, der gegenüber das Schicksal nur noch in der Form von Kausalitätsbeziehungen erscheint, bezeichnender als das ethische Pathos, mit dem man sich nun einer Philosophie der Verdauung, der Ernährung, der Hygiene zuwendet. Alkoholfragen und Vegetarismus werden mit religiösem Ernst behandelt, augenscheinlich das Gewichtigste an Problemen, wozu der »neue Mensch« sich aufschwingen kann. So entspricht es der Froschperspektive dieser Generationen. Religionen, wie sie an der Schwelle großer Kulturen entstehen, die orphische und vedische, das magische Christentum Jesu und das faustische der ritterlichen Germanen hätten es unter ihrer Würde gefunden, zu Fragen der Art auch nur für Augenblicke herabzusteigen. Jetzt steigt man zu ihnen hinauf. Der Buddhismus ist ohne eine leibliche neben seiner Seelendiät nicht denkbar. Im Kreise der Sophisten, des Antisthenes, der Stoiker und Skeptiker gewinnt dergleichen immer größere Bedeutung. Schon Aristoteles hat über die Alkoholfrage geschrieben, eine ganze Reihe von Philosophen über den Vegetarismus, und es besteht zwischen der apollinischen und der faustischen Methode nur der Unterschied, daß der Zyniker die eigne Verdauung, Shaw die Verdauung aller »Menschen« in sein theoretisches Interesse zieht. Der eine entsagt, der andere verbietet. Man weiß, wie selbst Nietzsche sich im »Ecce homo« in Fragen dieser Art gefällt.
17
Überblicken wir noch einmal den Sozialismus, unabhängig von der gleichnamigen Wirtschaftsbewegung, als das faustische Beispiel einer zivilisierten Ethik. Was seine Freunde und Feinde von ihm sagen, daß er die Gestalt der Zukunft oder daß er ein Zeichen des Niederganges sei, ist gleich richtig. Wir alle sind Sozialisten, ob wir es wissen und wollen oder nicht. Selbst der Widerstand gegen ihn trägt seine Form.
Alle antiken Menschen der späten Zeit waren mit der gleichen inneren Notwendigkeit Stoiker, ohne es zu wissen. Das ganze römische Volk, als Körper, hat eine stoische Seele. Der echte Römer, gerade der, welcher es am entschiedensten bestritten hätte, ist in einem strengeren Grade Stoiker, als es je ein Grieche hätte sein können. Die lateinische Sprache des letzten vorchristlichen Jahrhunderts ist die mächtigste Schöpfung des Stoizismus geblieben.
Der ethische Sozialismus ist das überhaupt erreichbare Maximum eines Lebensgefühls unter dem Aspekt von Zwecken.[Zum folgenden vgl. »Preußentum und Sozialismus«, S. 22 ff.] Denn die bewegte Richtung des Daseins, in den Worten Zeit und Schicksal fühlbar, bildet sich, sobald sie starr, bewußt, erkannt ist, in den geistigen Mechanismus der Mittel und Zwecke um. Richtung ist das Lebendige, Zweck das Tote. Faustisch überhaupt ist die Leidenschaft des Vordringens, sozialistisch im besonderen der mechanische Rest, der »Fortschritt«. Sie verhalten sich wie der Leib zum Skelett. Dies ist zugleich der Unterschied des Sozialismus vom Buddhismus und Stoizismus, die mit ihren Idealen des Nirwana und der Ataraxia ebenso mechanistisch gestimmt sind, aber nicht die dynamische Leidenschaft der Ausdehnung, den Willen zum Unendlichen, das Pathos der dritten Dimension kennen.
Der ethische Sozialismus ist – trotz seiner Vordergrundillusionen – kein System des Mitleids, der Humanität, des Friedens und der Fürsorge, sondern des Willens zur Macht. Alles andere ist Selbsttäuschung.
Das Ziel ist durchaus imperialistisch: Wohlfahrt, aber im expansiven Sinne, nicht der Kranken, sondern der Tatkräftigen, denen man die Freiheit des Wirkens geben will, und zwar mit Gewalt, ungehemmt durch die Widerstände des Besitzes, der Geburt und der Tradition. Gefühlsmoral, Moral auf das »Glück« und den Nutzen hin ist bei uns nie der letzte Instinkt, so oft es sich die Träger dieser Instinkte einreden. Man wird immer an die Spitze der moralischen Modernität Kant, in diesem Falle den Schüler Rousseaus, stellen müssen, dessen Ethik das Motiv des Mitleids ablehnt und die Formel prägt: » Handle so, daß –.« Alle Ethik dieses Stils will Ausdruck des Willens zum Unendlichen sein, und dieser Wille fordert Überwindung des Augenblicks, der Gegenwart, der Vordergründe des Lebens.
An Stelle der sokratischen Formel: »Wissen ist Tugend« setzte schon Bacon den Spruch: »Wissen ist Macht«. Der Stoiker nimmt die Welt, wie sie ist. Der Sozialist will sie der Form, dem Gehalt nach organisieren, umprägen, mit seinem Geist erfüllen. Der Stoiker paßt sich an. Der Sozialist befiehlt. Die ganze Welt soll die Form seiner Anschauung tragen – so läßt sich die Idee der »Kritik der reinen Vernunft« ins Ethische umsetzen. Das ist der letzte Sinn des kategorischen Imperativs, den er aufs Politische, Soziale, Wirtschaftliche anwendet: Handle so, als ob die Maxime deines Handelns durch deinen Willen zum allgemeinen Gesetz werden sollte. Und diese tyrannische Tendenz ist selbst den flachsten Erscheinungen der Zeit nicht fremd.
Nicht die Haltung und Gebärde, die Tätigkeit soll gestaltet werden. Wie in China und Ägypten kommt das Leben nur in Betracht, insofern es Tat ist. Und erst so, durch die Mechanisierung des organischen Bildes der Tat, entsteht die Arbeit im heutigen Sprachgebrauch als die zivilisierte Form faustischen Wirkens. Diese Moral, der Drang, dem Leben die denkbar aktivste Form zu geben, ist stärker als die Vernunft, deren Moralprogramme, sie mögen noch so geheiligt, inbrünstig geglaubt, leidenschaftlich verteidigt sein, nur insoweit wirken, als sie in der Richtung dieses Dranges liegen oder in ihr mißverstanden werden. Im übrigen bleiben sie Worte. Man unterscheide in aller Modernität wohl die volkstümliche Seite, das süße Nichtstun, die Sorge um Gesundheit, Glück, Sorglosigkeit, den allgemeinen Frieden, kurz das vermeintlich Christliche von dem höheren Ethos, das nur die Tat wertet, das den Massen – wie alles Faustische weder verständlich noch erwünscht ist, die großartige Idealisierung des Zweckes und also der Arbeit. Will man dem römischen » Panem et circenses«, dem letzten epikuräisch-stoischen und im Grunde auch indischen Lebenssymbol, das entsprechende Symbol des Nordens und auch wieder des alten China und Ägypten zur Seite stellen, so muß es das Recht auf Arbeit sein, das bereits dem durch und durch preußisch empfundenen, heute europäisch gewordnen Staatssozialismus Fichtes zugrunde liegt und das in den letzten, furchtbarsten Stadien dieser Entwicklung in der Pflicht zur Arbeit gipfeln wird.
Endlich das Napoleonische in ihm, das aere perennius, der Wille zur Dauer. Der apollinische Mensch sah auf ein goldenes Zeitalter zurück; das enthob ihn des Nachdenkens über das Kommende. Der Sozialist – der sterbende Faust des zweiten Teils – ist der Mensch der historischen Sorge, des Künftigen, das er als Aufgabe und Ziel empfindet, dem gegenüber das Glück des Augenblicks verächtlich wird. Der antike Geist mit seinen Orakeln und Vogelzeichen will die Zukunft nur wissen, der abendländische will sie schaffen. Das dritte Reich ist das germanische Ideal, ein ewiges Morgen, an das alle großen Menschen von Joachim von Floris bis Nietzsche und Ibsen – Pfeile der Sehnsucht nach dem andern Ufer, wie es im Zarathustra heißt – ihr Leben knüpften. Alexanders Leben war ein wundervoller Rausch, ein Traum, in dem das homerische Zeitalter noch einmal heraufbeschworen wurde; Napoleons Leben war eine ungeheure Arbeit, nicht für sich, nicht für Frankreich, sondern für die Zukunft überhaupt.
An dieser Stelle greife ich zurück und erinnere noch einmal daran, wie verschieden die großen Kulturen sich die Weltgeschichte vorgestellt haben: der antike Mensch sah nur sich, seine Geschicke als ruhende Nähe, und fragte nicht nach dem Woher und Wohin. Universalgeschichte ist ihm ein unmöglicher Begriff. Das ist eine statische Geschichtsauffassung. Der magische Mensch sieht Geschichte als das große Weltdrama zwischen Schöpfung und Untergang, als das Ringen zwischen Seele und Geist, Gut und Böse, Gott und Teufel, ein streng begrenztes Geschehen mit einer einmaligen Peripetie als Höhepunkt: der Erscheinung des Erlösers. Der faustische Mensch sieht in der Geschichte eine gespannte Entwicklung auf ein Ziel. Die Reihe: Altertum – Mittelalter – Neuzeit ist ein dynamisches Bild. Er kann sich Geschichte gar nicht anders vorstellen, und wenn dies nicht Weltgeschichte an sich und überhaupt, sondern lediglich das Bild einer Weltgeschichte faustischen Stils ist, das mit dem Wachsein der westeuropäischen Kultur beginnt und aufhört, wahr und vorhanden zu sein, so ist der Sozialismus im höchsten Sinne die logische und praktische Krönung dieser Vorstellung. In ihm erhält das Bild den von der Gotik an vorbereiteten Abschluß.
Und hier wird der Sozialismus – im Gegensatz zum Stoizismus und Buddhismus – tragisch. Es ist von tiefster Bedeutung, daß Nietzsche vollkommen klar und sicher ist, solange es sich um die Frage handelt, was zertrümmert, was umgewertet werden soll; er verliert sich in nebelhafte Allgemeinheiten, sobald das Wozu, das Ziel in Rede steht. Seine Kritik der Dekadenz ist unwiderleglich, seine Übermenschenlehre ist ein Luftgebilde. Und dasselbe gilt von Ibsen – von Brand und Rosmersholm, Julian Apostata und Baumeister Solneß –, von Hebbel, von Wagner, von allen. Und darin liegt eine tiefe Notwendigkeit, denn von Rousseau an gibt es für den faustischen Menschen, was den großen Stil des Lebens betrifft, nichts mehr zu hoffen. Hier ist etwas zu Ende. Die nordische Seele hat ihre innern Möglichkeiten erschöpft und es blieb nur noch der dynamische Sturm und Drang, wie er sich in welthistorischen Zukunftsvisionen äußert, die mit Jahrtausenden messen, der bloße Trieb, die nach Schöpfung sich sehnende Leidenschaft, eine Form ohne Inhalt. Diese Seele war Wille und nichts andres; sie brauchte ein Ziel für ihre Kolumbussehnsucht; sie mußte einen Sinn und Zweck ihrer Wirksamkeit sich wenigstens vortäuschen, und so findet der feinere Beobachter einen Zug von Hjalmar Ekdal in aller Modernität, auch in ihren höchsten Erscheinungen. Ibsen hat es die Lebenslüge genannt. Nun, etwas von ihr liegt in der gesamten Geistigkeit der westeuropäischen Zivilisation, insoweit sie auf eine religiöse, künstlerische, philosophische Zukunft, ein sozialethisches Ziel, ein drittes Reich sich richtet, während in der tiefsten Tiefe ein dumpfes Gefühl nicht schweigen will, daß dieser ganze atemlose Eifer die verzweifelte Selbsttäuschung einer Seele ist, die nicht ruhen darf und kann. Aus dieser tragischen Situation – der Umkehrung des Hamletmotivs – ist Nietzsches gewaltsame Konzeption der Ewigen Wiederkunft hervorgegangen, an die er niemals mit gutem Gewissen geglaubt hat, die er aber trotzdem festhielt, um das Gefühl einer Sendung in sich zu retten. Auf dieser Lebenslüge ruht Bayreuth, das etwas sein wollte im Gegensatz zu Pergamon, das etwas war. Und ein Zug dieser Lüge haftet dem gesamten politischen, wirtschaftlichen, ethischen Sozialismus an, der gewaltsam über den vernichtenden Ernst seiner letzten Einsichten schweigt, um die Illusion der geschichtlichen Notwendigkeit seines Daseins zu retten.
QUELLE: Projekt Gutenberg / Oswald Spengler
(Hervorhebungen HTH)
Widerlegung Darwins
Vorbemerkung HTH: Man wird vermutlich in den heutigen geschlossenen Wissenschaftsanstalten (anders kann man die einstmals freien Universitäten nicht bezeichnen) niemanden finden, der eine Dissertation verfasst mit dem Ziel, die Evolutionstheorie von Darwin zu widerlegen. In den USA werden die „Creationisten“ als liebenswürdige Sonderlinge behandelt, aber sicher nicht als ernst zu nehmende Gegner von Darwins Theorie. Der letzte, der immerhin noch Lücken der Evolutionstheorie bemerkt hat, war Konrad Lorenz.
"Der fortschreitende Verfall unserer Kultur ist so offensichtlich pathologischer Natur, trägt so offensichtlich die Merkmale einer Erkrankung des menschlichen Geistes, daß sich daraus die kategorische Forderung ergibt, Kultur und Geist mit der Fragestellung der medizinischen Wissenschaft zu untersuchen. [...] Die meisten unter den Geisteskrankheiten und Störungen, die den Weiterbestand unserer Kultur in Frage stellen, betreffen das ethische und das moralische Verhalten des Menschen", schreibt Lorenz in seinem „Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens“, besser bekannt unter dem Titel „Die Rückseite des Spiegels“.
Nach Darwin müssen, nach Lorenz dürfen wir voraussetzen: die Evolution dient der Arterhaltung, der Mechanismus der Arterhaltung ist die Selektion, Prinzipien der Selektion sind Zufall und Notwendigkeit (beide gleichzeitig, nicht entweder oder!). Die Evolution wirkt von den niedrigsten bis zu den höchsten Lebewesen, vom Pantoffeltierchen bis zum Menschen, mit dem immer gleichen Mechanismus auf Basis der immer gleichen Prinzipien. Die Erkenntnis des Pantoffeltierchens, dass es einem Gegenstand (Widerstand) links oder rechts ausweichen kann, unterscheidet sich von der Erkenntnis eines Menschen, dass er als Lenker eines Autos links oder rechts abbiegen kann, nur graduell, nicht prinzipiell.
Die Feststellung von Lorenz, dass beide Lebewesen über einen Wahrnehmungsapparat bzw. Erkenntnisapparat verfügen, ist allerdings keine zureichende Erklärung, dass durch Evolution aus Pantoffeltierchen nach Jahrmillionen Menschen werden. Würden sich tatsächlich nur die Lebewesen evolutionär weiter entwickeln, die sich am besten angepasst haben, warum sind dann so viele Pantoffeltierchen übrig geblieben, die immer noch ein primitives Dasein führen, wie vor Jahrmillionen?
Der Begriff der Evolution impliziert eine langsame Entwicklung, im Gegensatz zur Revolution. Lorenz erkennt aber die Entwicklungssprünge, die dieser Erklärung widersprechen und weicht daher in die Mystik aus: Wörter Entwicklung, Development, Evolution [...] versagen geradezu kläglich, wenn man versucht, dem Wesen des organischen Schöpfungsvorganges gerecht zu werden, das eben darin besteht, daß immer wieder etwas völlig Neues in Existenz tritt, etwas das vorher einfach nicht da war. [...] Theistische Philosophen und Mystiker des Mittelalters haben für den Akt einer Neuschöpfung den Ausdruck 'Fulguratio', Blitzstrahl, geprägt. Sie wollten damit zweifellos die unmittelbare Einwirkung von oben, von Gott her, zum Ausdruck bringen."
Letztlich konzediert Lozenz, „daß es uns nie gelingen kann, die Entstehung des höheren lebendigen Wesens aus seinen niedrigeren Vorfahren restlos zu erklären. Das höhere Lebewesen ist, wie vor allem Michael Polanyi betont hat, nicht auf seine einfacheren Vorfahren 'reduzierbar', und noch weniger kann das lebende System auf anorganische Materie und die in ihr sich abspielenden Vorgänge 'reduziert' werden.“ Lorenz hat sein Buch vor über 50 Jahren veröffentlicht, Oswald Spengler vor mehr als 100 Jahren; genau 1922 erschien der zweite Band „Welthistorische Perspektiven“, worin sich auch die „Widerlegung Darwins“ findet.
HIER DER WORTLAUT zitiert aus dem Projekt Gutenberg
Es kann keine bündigere Widerlegung Darwins geben als die Ergebnisse der Paläontologie. Die Versteinerungsfunde können nach einfacher Wahrscheinlichkeit nur Stichproben sein. Jedes Stück müßte also eine andere Entwicklungsstufe darstellen. Es gäbe nur »Übergänge«, keine Grenzen und also keine Arten. Statt dessen finden wir aber vollkommen feststehende und unveränderte Formen durch lange Zeiträume hin, die sich nicht etwa zweckmäßig herausgebildet haben, sondern die plötzlich und sofort in endgültiger Gestalt erscheinen, und die nicht in noch zweckmäßigere übergehen, sondern seltener werden und verschwinden, während ganz andre Formen schon wieder aufgetaucht sind. Was sich in immer größerem Formenreichtum entfaltet, sind die großen Klassen und Gattungen der Lebewesen, die von Anfang an und ohne alle Übergänge in der heutigen Gruppierung da sind. Wir sehen, wie unter den Fischen die Selachier mit ihren einfachen Formen in zahlreichen Gattungen zuerst in den Vordergrund der Geschichte treten und langsam wieder zurücktreten, während die Teleostier eine vollendetere Form des Fischtypus allmählich zur Herrschaft bringen, und dasselbe gilt von den Pflanzenformen der Farne und Schachtelhalme, die heute mit ihren letzten Arten in dem voll entwickelten Reich der Blütenpflanzen fast verschwinden. Aber dafür zweckmäßige und überhaupt sichtbare Ursachen anzunehmen, fehlt jeder wirkliche Anhalt.
[FN: Den ersten Beweis dafür, daß die Grundformen der Pflanzen- und Tierwelt sich nicht entwickeln, sondern plötzlich da sind, gab H. de Vries seit 1886 in seiner Mutationslehre. In der Sprache Goethes: Wir sehen, wie eine geprägte Form sich in den einzelnen Exemplaren entwickelt, nicht, wie sie für die ganze Gattung geprägt wird.]
Es ist ein Schicksal, welches das Leben überhaupt, den immer wachsenden Gegensatz von Pflanze und Tier, jeden einzelnen Typus, jede Gattung und Art in die Welt berief. Und mit diesem Dasein ist zugleich eine bestimmte Energie der Form gegeben, mit welcher sie sich im Fortgang der Vollendung rein behauptet oder matt und unklar wird und in viele Abarten ausweicht oder zerfällt, und damit zugleich eine Lebensdauer dieser Form, die wiederum zwar durch einen Zufall verkürzt werden kann, sonst aber zu einem natürlichen Alter und Verlöschen der Art führt.
Und was den Menschen betrifft, so zeigen die diluvialen Funde immer deutlicher, daß alle damals vorhandenen Formen den heute lebenden entsprechen und nicht die geringste Spur einer Entwicklung zu einer zweckmäßiger gebauten Rasse zeigen, und das Fehlen aller tertiären Funde deutet immer mehr darauf hin, daß die Lebensform des Menschen wie jede andre ihren Ursprung einer plötzlichen Wandlung verdankt, deren Woher, Wie und Warum ein undurchdringliches Geheimnis bleiben wird. In der Tat, gäbe es eine Evolution im englischen Sinne, so könnte es weder abgegrenzte Erdschichten noch einzelne Tierklassen geben, sondern nur eine einzige geologische Masse und ein Chaos lebender Einzelformen, die im Kampf ums Dasein übriggeblieben wären. Aber alles, was wir sehen, zwingt uns zu der Überzeugung, daß immer wieder tiefe und sehr plötzliche Änderungen im Wesen des Tier- und Pflanzendaseins vor sich gehen, die von kosmischer Art und niemals auf das Gebiet der Erdoberfläche beschränkt sind und die dem menschlichen Empfinden und Verstehen in ihren Ursachen oder überhaupt entzogen bleiben.
[FN: Damit wird auch die Annahme ungeheurer Zeiträume für die Ereignisse der menschlichen Urzeit überflüssig und man kann den Abstand der ältesten bisher bekannten Menschen vom Beginn der ägyptischen Kultur sich in einem Zeitmaß denken, dem gegenüber die 5000 Jahre historischer Kultur durchaus nicht verschwinden.]
Und ganz ebenso sehen wir, wie diese raschen und tiefen Verwandlungen in die Geschichte der großen Kulturen eingreifen, ohne daß von sichtbaren Ursachen, Einflüssen und Zwecken irgendwie die Rede sein kann. Die Entstehung des gotischen und des Pyramidenstils vollzog sich ebenso plötzlich wie die des chinesischen Imperialismus unter Schi Hoang-ti und des römischen unter Augustus, wie die des Hellenismus, des Buddhismus, des Islam, und ganz ebenso steht es mit den Ereignissen in jedem bedeutenden Einzelleben. Wer das nicht weiß, ist kein Menschenkenner, vor allem kein Kinderkenner. Jedes tätige oder betrachtende Dasein schreitet in Epochen seiner Vollendung zu, und eben solche Epochen müssen wir in der Geschichte des Sonnensystems und der Welt der Fixsterne annehmen. Der Ursprung der Erde, der Ursprung des Lebens, der Ursprung des frei beweglichen Tieres sind solche Epochen und ebendeshalb Geheimnisse, die wir als solche hinzunehmen haben. (S. 726 ff)
VOLK und RASSE
[Anm. HTH: Beide Begriffe sind heute wissenschaftlich verpönt und werden von Sprachpolizisten der „political correctness“ verfolgt. Spengler wird (meist von jenen, die ihn nicht gelesen haben) in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt, doch der folgende Ausschnitt beweist, dass seine Thesen nicht nur weit weg von der NS-Ideologie stehen, sondern dieser sogar widersprechen. Der Begriff der „Rasse“ war noch bis in die Zwischenkriegszeit alltäglich und so unverdächtig, wie heute die Begriffe der Abstammung und Herkunft. Für Spengler ist der Begriff „Rasse“ verwandt mit den Begriffen „Geschlecht“, „Adel“ und „Stand“, Rassismus im Geiste der Nazis hat er zurückgewiesen.]
HIER DER WORTLAUT zitiert aus Projekt Gutenberg
Hier stehen wir vor dem Lieblingsbegriff des modernen Geschichtsdenkens. Trifft ein Historiker heute auf ein Volk, das etwas geleistet hat, so ist er ihm gewissermaßen die Frage schuldig: von woher kam es? Es gehört zum Anstand eines Volkes, von irgendwoher gekommen zu sein und eine Urheimat zu haben. Daß es auch dort zu Hause sein könne, wo man es vorfindet, ist eine fast beleidigende Annahme. Wandern ist ein beliebtes Sagenmotiv ursprünglicher Menschheit, aber seine Anwendung in der ernsthaften Forschung ist nachgerade zu einer Manie geworden. Ob überhaupt die Chinesen nach China, die Ägypter nach Ägypten eingedrungen sind, danach wird nicht gefragt; nur das Wann und Woher steht in Frage. Man würde lieber die Semiten aus Skandinavien und die Arier aus Kanaan stammen lassen, als auf den Begriff einer Urheimat verzichten. (S. 912)
Für mich ist »Volk« eine Einheit der Seele. Alle großen Ereignisse der Geschichte sind nicht eigentlich von Völkern ausgeführt worden, sondern haben Völker erst hervorgerufen. Jede Tat verändert die Seele des Handelnden. Mag man sich zuerst um einen berühmten Namen geschart haben, – daß hinter seinem Klange nicht ein Haufe, sondern ein Volk steht, das ist die Wirkung und nicht die Voraussetzung großer Ereignisse. Erst durch ihre Wanderschicksale sind Goten und Osmanen geworden, was sie später waren. »Die Amerikaner« sind nicht aus Europa eingewandert; der Name des florentinischen Geographen Amerigo Vespucci bezeichnet heute zunächst einen Erdteil, aber außerdem ein echtes Volk, das durch die seelische Erschütterung von 1775 und vor allem durch den Sezessionskrieg von 1861–65 seine Eigenart erhalten hat.
Einen anderen Inhalt des Wortes Volk gibt es nicht. Weder die Einheit der Sprache noch der leiblichen Abstammung ist entscheidend. Was ein Volk von einer Bevölkerung unterscheidet, es aus dieser abhebt und wieder in ihr aufgehen läßt, ist stets das innere Erlebnis des »Wir«. Je tiefer dieses Gefühl, desto stärker ist die Lebenskraft des Verbandes. Es gibt energische, matte, flüchtige, unverwüstliche Völkerformen. Sie können Sprache, Rasse, Namen und Land wechseln; solange ihre Seele dauert, eignen sie sich Menschen jeder denkbaren Herkunft innerlich an und formen sie um.
Der römische Name bezeichnet zur Zeit Hannibals ein Volk, zur Zeit Trajans nur noch eine Bevölkerung.
Wenn trotzdem mit vielem Rechte Völker und Rassen zusammengestellt werden, so ist damit nicht der heute übliche Rassebegriff der darwinistischen Zeit gemeint. Man glaube doch nicht, daß je ein Volk durch die bloße Einheit der leiblichen Abstammung zusammengehalten wurde und diese Form auch nur durch zehn Generationen hätte wahren können. Es kann nicht oft genug wiederholt werden, daß diese physiologische Herkunft nur für die Wissenschaft und niemals für das Volksbewußtsein vorhanden ist und daß kein Volk sich je für dieses Ideal des »reinen Blutes« begeistert hat. »Rasse haben« ist nichts Stoffliches, sondern etwas Kosmisches und Gerichtetes, gefühlter Einklang eines Schicksals, gleicher Schritt und Gang im historischen Sein. Aus einem Mißverhältnis dieses ganz metaphysischen Taktes entspringt der Rassehaß, der zwischen Franzosen und Deutschen nicht weniger stark ist als zwischen Deutschen und Juden, und aus dem gleichen Pulsschlag andererseits die wirkliche, dem Haß verwandte Liebe zwischen Mann und Weib. Wer keine Rasse hat, der kennt diese gefährliche Liebe nicht. Wenn ein Teil der Menschenmasse, die sich heute indogermanischer Sprachen bedient, einem gewissen Rasseideal sehr nahe steht, so deutet das auf die metaphysische Kraft dieses Ideals, das züchtend wirkte; und nicht auf ein »Urvolk« im gelehrten Geschmack. Es ist doch von höchster Bedeutung, daß dieses Ideal niemals in der gesamten Bevölkerung, sondern vorwiegend in ihrem kriegerischen Element und vor allem dem echten Adel ausgeprägt ist, also unter den Menschen, welche ganz in einer Tatsachenwelt, im Banne geschichtlichen Werdens leben, Schicksalsmenschen, die etwas wollen und wagen, obwohl gerade in früher Zeit die Aufnahme in den Herrenstand einem Stammfremden von äußerem und innerem Range nicht schwer fiel und zumal die Weiber nach ihrer »Rasse« und gewiß nicht ihrer Abstammung gewählt worden sind. Am schwächsten sind die Rassezüge gleich daneben, wie man heute noch beobachten kann, in den echten Priester- und Gelehrtennaturen ausgeprägt,
[FN:Die eben deshalb den sinnlosen Begriff Geistesadel erfunden haben.]
obwohl sie mit den andern vielleicht in engster Blutsverwandtschaft stehen. Ein starkes Seelentum züchtet den Leib wie ein Kunstwerk heran. Die Römer bilden, mitten in dem italischen Wirrwarr der Stämme und selbst von verschiedenartigster Herkunft, eine Rasse von der allerstrengsten inneren Einheit, die weder etruskisch noch latinisch oder allgemein »antik«, sondern ganz spezifisch römisch ist.
(FNObwohl gerade in Rom die Freigelassenen, also in der Regel Menschen ganz fremden Blutes, das Bürgerrecht erhalten und schon der Zensor Appius Claudius (310) Söhne ehemaliger Sklaven in den Senat aufnahm. Einer von ihnen, Flavius, ist damals sogar kurulischer Ädil geworden.]
Wenn man irgendwo die Stärke eines Volkstums vor Augen sehen kann, so ist es an den Römerbüsten der letzten republikanischen Zeit. (917 ff)
Alle Nationen des Abendlandes sind dynastischen Ursprungs. Noch in der romanischen und frühgotischen Baukunst schimmerte die Seele der karolingischen Urvölker durch. Es gibt keine französische und deutsche Gotik, sondern eine salfränkische, rheinfränkische, schwäbische, und ebenso eine westgotische – Südfrankreich und Nordspanien verbindende –, langobardische und sächsische Romanik. Aber darüber breitet sich doch schon die Minderheit von Rassemenschen aus, welche ihre Zugehörigkeit zu einer Nation im Sinne einer großen historischen Sendung empfinden. Von ihnen gehen die Kreuzzüge aus, in denen es wirklich ein deutsches und französisches Rittertum gibt. Es ist das Kennzeichen faustischer Völker, daß sie sich der Richtung ihrer Geschichte bewußt sind. Diese Richtung aber haftet an der Geschlechterfolge. Das Rasseideal ist durchaus genealogischer Natur – in dieser Hinsicht ist der Darwinismus mit seinen Vererbungs- und Abstammungslehren beinahe eine Karikatur der gotischen Heraldik –, und die Welt als Geschichte, in deren Bild jeder einzelne lebt, enthält nicht nur den Stammbaum der einzelnen Familie, der herrschenden voran, sondern auch den der Völker als Grundform alles Geschehens. Man muß sehr genau zusehen, um zu bemerken, daß den Ägyptern und Chinesen das faustisch-genealogische Prinzip mit den eminent historischen Begriffen der Ebenbürtigkeit und des reinen Blutes ebenso fremd ist wie dem römischen Adel und dem byzantinischen Kaisertum. Dagegen ist weder unser Bauerntum noch das Patriziat der Städte ohne diese Idee denkbar. Der gelehrte Begriff Volk, den ich oben zergliedert hatte, stammt wesentlich aus dem genealogischen Empfinden der gotischen Zeit. Der Gedanke eines Stammbaums der Völker hat den Stolz der Italiener, Erben der Römer zu sein, und die Berufung der Deutschen auf ihre germanischen Vorfahren zur Folge gehabt, und das ist etwas ganz anderes als der antike Glaube an die zeitlose Abkunft von Helden und Göttern. Er hat zuletzt, als seit 1789 die Muttersprache dem dynastischen Prinzip hinzugefügt wurde, die ursprünglich rein wissenschaftliche Phantasie von einem indogermanischen Urvolk zu einer tiefgefühlten Genealogie der »arischen Rasse« ausgestaltet, wobei das Wort Rasse fast eine Bezeichnung für Schicksal geworden ist.
Aber die »Rassen« des Abendlandes sind nicht die Schöpfer der großen Nationen, sondern ihre Folge. Sie sind sämtlich zur Karolingerzeit noch nicht vorhanden gewesen. Es ist das Standesideal der Ritterschaft, das in Deutschland wie in England, Frankreich und Spanien in verschiedener Richtung züchtend gewirkt und in weitem Umfange das durchgesetzt hat, was heute innerhalb der einzelnen Nationen als Rasse gefühlt und erlebt wird. Darauf beruhen, wie erwähnt, die historischen und deshalb der Antike ganz fremden Begriffe des reinen Blutes und der Ebenbürtigkeit. Weil das Blut des herrschenden Geschlechts das Schicksal, das Dasein der gesamten Nation verkörpert, hat das Staatensystem des Barock eine rein genealogische Struktur und die Mehrzahl der großen Krisen die Form von Erbfolgekriegen angenommen. Noch die Katastrophe Napoleons, welche der Welt für ein Jahrhundert ihre politische Gliederung gab, vollzog sich in der Gestalt, daß ein Abenteurer es wagte, durch sein Blut das der alten Dynastien zu verdrängen, und daß dieser Angriff auf ein Symbol dem Widerstand gegen ihn die historische Weihe gab. Denn alle diese Völker waren die Folge dynastischer Schicksale. Daß es ein portugiesisches Volk gibt und damit auch einen portugiesischen Staat Brasilien mitten im spanischen Südamerika, ist die Folge der Heirat des Grafen Heinrich von Burgund (1095). Daß es Schweizer und Holländer gibt, ist die Folge einer Auflehnung gegen das Haus Habsburg. Daß es Lothringen als Namen eines Landes, aber nicht als Volk gibt, ist die Folge der Kinderlosigkeit Lothars II. Es ist die Kaiseridee, welche eine Anzahl von Urvölkern der karolingischen Zeit zur deutschen Nation verschmolzen hat. Deutschland und Kaisertum sind untrennbare Begriffe. (940 ff)
